Als die Covid-19-Pandemie Afrika heimsuchte, musste das Gesundheitspersonal des Kontinents sie ohne angemessene Ausrüstung bekämpfen: In den afrikanischen Ländern mangelte es an Beatmungsgeräten, Intensivstationen und Schutzausrüstung für das medizinische Personal. Als dann endlich Impfstoffe gegen das Virus entwickelt waren, wurden sie von wohlhabenden Ländern gehortet; erst nach langen Verzögerungen erhielten afrikanische Länder ausreichend Vakzine. Auch Medikamente zur Behandlung der Krankheit waren Mangelware.
Nach dieser Erfahrung erklärten afrikanische Staatsführer, sie würden darauf hinarbeiten, die Gesundheitssicherung von internationalen Systemen weniger abhängig zu machen. Sie unternehmen seitdem Anstrengungen, leistungsfähigere öffentliche Gesundheitseinrichtungen zu schaffen, die lokale Arzneimittelproduktion zu erhöhen und die Koordination im Fall von Gesundheitsnotlagen zu verbessern.
Jede Woche mindestens zwei bis drei akute Gesundheitskrisen
Jede Woche treten in Afrika mindestens zwei bis drei akute Gesundheitskrisen auf, sagt Fiona Braka, die Managerin für Notfallmaßnahmen im Regionalbüro für Afrika der Weltgesundheitsorganisation WHO. Neben den nationalen Regierungen sind eben die WHO und die afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Africa CDC) für die Reaktion auf solche Notlagen zuständig. Und beide sind seit der Covid-19-Pandemie gestärkt worden.
Africa CDC war noch jung, als Covid-19 ausbrach: Es ist 2017 als spezialisierte Facheinrichtung der Afrikanischen Union (AU) gegründet worden. Dennoch konnte es unter Leitung ihres ersten Direktors, John Nkengasong, wirksame Corona-Maßnahmen in Afrika anführen: Eine gemeinsame Beschaffungsplattform wurde ins Leben gerufen, die Verteilung von Tests organisiert, Laborkapazitäten wurden erweitert und die Voraussetzungen für die Verteilung von Impfstoffen geschaffen. All dies leitete Africa CDC in die Wege, obwohl es nur wenige Mittel hatte und die AU-Bürokratie es belastete und bremste.
Anfang 2022 beschlossen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs, Africa CDC mehr Autonomie gegenüber der AU zu geben – eine Lehre aus der Covid-Krise: Sie räumten ihm größere Befugnisse und mehr Flexibilität ein, damit es schnell auf Gesundheitskrisen reagieren kann. Anfang 2023 wurde der erste Generaldirektor ernannt, Jean Kaseya, und Africa CDC kann nun „Gesundheitsnotlagen für die Sicherheit des Kontinents“ erklären. Damit hat Africa CDC die Befugnis, kontinentweite Maßnahmen anzuleiten und zu koordinieren. Das kann auch genutzt werden, um internationale Aufmerksamkeit zu schaffen und Mittel für den Kampf gegen eine Krankheit zu mobilisieren.
Drei wichtige Initiativen der WHO
Das Afrika-Regionalbüro der WHO hat seinerseits seit 2022 drei wichtige Initiativen gestartet, um die afrikanischen Länder in die Lage zu versetzen, Krankheitsausbrüche besser zu verhüten oder einzudämmen. Die erste Initiative konzentriert sich auf Vorbereitung. Die WHO hat in Kenia in Nairobi und im Senegal in Dakar zwei regionale Warenlager eingerichtet, um im Notfall schneller medizinische Güter in betroffene Länder bringen zu können. Davor war sie in Afrika weitgehend auf ihr Zentrallager in Dubai sowie auf ein Depot in Accra (Ghana) angewiesen, das vom Welternährungsprogramm verwaltet wird. Unter diesen Bedingungen benötigte die WHO etwa 25 Tage, um Güter lokaler und internationaler Anbieter wie Medikamente, Impfstoffe und diagnostische Tests dorthin zu schaffen, wo sie gebraucht wurden; mit den beiden neuen Vertriebszentren auf dem Kontinent konnte diese Zeitspanne auf etwa 24 bis 72 Stunden verkürzt werden, so Braka.
Die zweite Initiative fördert Fähigkeiten, Krankheitsausbrüche früh zu entdecken. So hat sich die Zahl der afrikanischen Länder, die über das Integrierte Krankheitsüberwachungs- und -bekämpfungssystem der WHO Bericht erstatten, von 10 auf 44 erhöht. Das hat die Meldepraxis verbessert: Jetzt werden laut Braka Gefahren für die öffentliche Gesundheit in Afrika in mehr als 62 Prozent der Fälle binnen einer Woche erkannt; 2017 seien es nur 23 Prozent gewesen. Die WHO hat sich auch für mehr Diagnosemöglichkeiten stark gemacht; unter anderem hat sie Mpox-Testkits bereitgestellt und die Kapazitäten für Genom-Überwachung ausgebaut; mit dieser Labortechnik kann medizinisches Fachpersonal Veränderungen im Erbgut von Krankheitserregern verfolgen, dazu sind die meisten Länder Afrikas inzwischen in der Lage.
Autorin
Sara Jerving
ist Senior Reporter für die entwicklungspolitische Online-Publikation „Devex“ und berichtet über globale Gesundheitsfragen.Die dritte Initiative der WHO sollte rasche und wirksame Reaktionen auf Krankheitsausbrüche gewährleisten. Mehr als 2000 Notfallspezialisten sind ausgebildet worden und können innerhalb von 24 bis 48 Stunden eingesetzt werden. Zu ihnen gehören Epidemiologen, Insektenkundler, Anthropologen, Tierärzte, Datenmanager und Fachleute für Bereiche wie Logistik, Infektionsvorbeugung, Risikokommunikation und Einbeziehung der Bevölkerung, Finanzen und Verwaltung, Wasser und sanitäre Einrichtungen, geschlechtsspezifische Gewalt sowie Ernährung. „In Verbindung mit Notfallzentren, die die Vorlaufzeit für die Versorgung auf nur drei Tage verkürzen, war das entscheidend dafür, die Ausbreitung von Ebola und des Marburg-Fiebers über Staatsgrenzen zu verhindern. Und es erweist sich auch als entscheidend im Kampf gegen Mpox“, so Braka.
Africa CDC und die WHO arbeiten jetzt enger zusammen. Die afrikanischen Staatsoberhäupter haben sich außerdem im Februar 2022 darauf geeinigt, einen Afrika-Epidemiefonds einzurichten, der die Länder bei der Vorbereitung und Reaktion auf Krankheiten unterstützen soll. Aber laut Ngashi Ngongo vom Africa CDC ist dieser Fonds noch nicht eingerichtet, die Verfahren innerhalb der AU laufen noch; die Africa CDC nutze den derzeitigen Mpox-Ausbruch, um auf eine Beschleunigung zu drängen.
Der Mpox-Ausbruch als Testfall
Das Mpox-Virus, auch Affenpocken genannt, wurde erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo entdeckt. Es ist vor allem in Zentralafrika in Tieren weit verbreitet und befällt auch Menschen. Als es sich 2022 außerhalb Afrikas ausbreitete, erklärte die WHO 2022 eine „Gesundheitsnotlage von internationaler Reichweite“. Diese höchste Alarmstufe endete offiziell, als im Juli 2023 die Fälle weltweit zurückgingen. Aber in der Demokratischen Republik Kongo stiegen die Fallzahlen weiter an. Mitte August 2024 deklarierte Africa CDC den Mpox-Ausbruch als kontinentalen Gesundheitsnotstand, da eine neue Variante des Virus auf andere Länder übergriff, und machte damit erstmals von seiner neuen Befugnis Gebrauch. Einen Tag später rief die WHO wieder eine Notlage von globaler Bedeutung aus.
Mpox ist in gewisser Weise ein Test, wie wirksam die Veränderungen der letzten Jahre die Reaktion auf Krankheitsausbrüche in Afrika verbessert haben. Im Vergleich zu früher gibt es diesmal ein höheres Maß an Koordination. Zum ersten Mal haben die WHO und Africa CDC ein gemeinsames afrikaweites Koordinationsteam, einen gemeinsamen Einsatzplan, ein gemeinsames Budget und einen gemeinsamen Rahmen für Monitoring und Evaluierung.
Der Mpox-Ausbruch macht aber auch deutlich, dass weltweite strukturelle Ungleichheit im Gesundheitssektor die Bewältigung von Notsituationen in Afrika immer noch behindert. Das medizinische Personal wurde wieder ohne angemessene Ausrüstung wie zum Beispiel Mittel zur Schnelldiagnostik in den Kampf geschickt und hatte wieder nur schleppend Zugang zu Impfstoffen.
Der Ausbruch der Krankheit konzentriert sich auf die DR Kongo. Fiona Braka von der WHO nennt die größten Probleme für die Bekämpfung der Epidemie dort: In dem Gebiet von der Größe Westeuropas müssen Kühlketten für Impfstoffe errichtet werden. Man muss isolierte Gemeinschaften in abgelegenen Gebieten erreichen, in denen es kaum Straßen gibt oder wo kriegerische Konflikte anhalten. Und die Menschen dort sind neben Mpox von anderen Notlagen betroffen wie Vertreibung und Unterernährung.
Laut Tchass Chasinga, Medizinbiologe im Labor des Panzi-Krankenhauses in Süd-Kivu in der DR Kongo, gibt es Labore hauptsächlich in einigen wenigen Städten; anderswo habe man nur begrenzt Zugang zu Mitteln der Molekularbiologie. Da auch Schnelldiagnosetests für Mpox fehlten, müsse man oft Proben von einer Provinz in eine andere transportieren. „In Gebieten, in denen es kein Labor gibt, verzögert sich der Virusnachweis. Manche Patienten werden drei bis vier Wochen isoliert, ohne dass ihr Befund bekannt ist. Das geht so weit, dass sie sich erholen und das Krankenhaus ohne Diagnose verlassen“, berichtet Chasinga. Dies könne dazu führen, dass die Zahl der Fälle überschätzt wird, dass Patienten fälschlich isoliert werden und dass sich Gemeinden weigern, zu akzeptieren, dass es dort die Krankheit gibt.
Wenn mit Mpox Infizierte nicht in die Klinik kommen, stecken sie Verwandte, Freunde und Nachbarn an – und es kann schwierig sein, nachzuverfolgen, mit wem sie Kontakt hatten, sagt Isaac Muyonga, Professor für Öffentliche Gesundheit an der Freien Universität der Länder der Großen Seen in Butembo und Goma. Mpox wird durch engen Körperkontakt, einschließlich Sex, und durch mit dem Virus verunreinigte Gegenstände übertragen. In den überfüllten Vertriebenenlagern in Goma die Ausbreitung zu verhindern, wird immer schwieriger.
Zudem ist das Angebot an Impfstoffen begrenzt und sie werden in reichen Ländern gehortet, in denen Mpox keine größere Gefahr ist; das hat die Ankunft von Vakzinen in Afrika verzögert, sagt Braka. Länder wie Japan, die USA und Kanada haben Impfstoffvorräte gegen Pocken für den Fall, dass diese Seuche zurückkehrt, und die schützen auch gegen Mpox. Ende September 2024 gab es weltweit nur 711.000 Dosen für den Versand nach Afrika, und die trudeln nur langsam ein. Deshalb konnte man nur in Zentren des Ausbruchs mit der Impfung beginnen, für einen flächendeckenden Einsatz war nicht genug Impfstoff vorhanden, sagt Chasinga.
In der DR Kongo gibt es laut Muyonga auch weder genügend Gemeindegesundheitshelfer, um alle Haushalte zu beobachten, noch sind diese in der Lage, Fallwarnungen schnell weiterzugeben. Auch sieht er kaum Fortschritte bei der Umsetzung des „One Health“-Konzepts. Diese Gesundheitsstrategie betont die enge Verbindung zwischen der menschlichen Gesundheit und der von Tieren und Ökosystemen. In der DR Kongo geht es unter anderem darum zu verhindern, dass Krankheitserreger von Tieren auf Menschen übergehen. Kulturelle Praktiken wie die, Affenfleisch zu verzehren, erschweren das, so Muyonga: „Unter solchen Bedingungen ist es schwierig, Epidemien einzudämmen.“
Wirksame Maßnahmen bei Ebola und dem Marburg-Fieber
Als wirksamer haben sich Maßnahmen gegen andere Krankheitsausbrüche erwiesen, zum Beispiel bei Ebola – dank Diagnoseinstrumenten, Impfstoffen und einem Programm zur Nachverfolgung von Überlebenden in der DR Kongo, sagt Chasinga. Nachverfolgung ist von entscheidender Bedeutung, weil das Ebola-Virus im Gehirn, den Augen und den Hoden von Überlebenden überdauern und – wenn auch selten – neue Ausbrüche hervorrufen kann.
In Ruanda wurde der erste Ausbruch des Marburg-Fiebers, einer Ebola ähnlichen Krankheit, wirksam eingedämmt. Beide Krankheiten sind von Viren verursachte hämorrhagische Fieber, das heißt, sie lösen innere Blutungen aus. Für Marburg-Fieber gibt es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine Therapie, und die Sterblichkeit kann bis zu 88 Prozent betragen. Man stellte in Ruanda Ende September die ersten Fälle fest. Doch das Land, das für sein großes Engagement für öffentliche Gesundheit bekannt ist, konnte die Sterblichkeitsrate unter 23 Prozent halten, eine der niedrigsten, die jemals für hämorrhagische Fieber verzeichnet wurden.
Laut dem ruandischen Gesundheitsminister Yvan Butera hatte das Land seine Gesundheitsinfrastruktur und die Intensivstationen ausgebaut und das Personal für Notfallmedizin aufgestockt. Schnelltests mit einer kurzen Bearbeitungszeit im Labor, gefolgt von der Isolierung der Patienten, „haben dazu geführt, dass die Fälle schnell entdeckt und in sehr, sehr frühen Phasen der Krankheit behandelt werden konnten“, sagt er. Die Behandlung umfasst Infusionen von Flüssigkeit und die frühzeitige Behandlung von Komplikationen. Außerdem hat Gilead Sciences sein antivirales Medikament Remdesivir an Ruanda gespendet. Dieses Mittel ist zwar nicht für die Behandlung von Marburg-Infektionen zugelassen, wurde aber während dieses Ausbruchs versuchsweise eingesetzt. Auch ein Kandidat für einen Impfstoff wurde ausprobiert. Ende Dezember war der Ausbruch der Krankheit offiziell beendet.
Schon bevor die Krankheit im September auftrat, hatte die WHO Ruanda bei der Vorbereitung auf hämorrhagische Fieber wie Marburg und Ebola unterstützt, sagt Braka – etwa bei der Schulung des Gesundheitspersonals. Auch die Diagnosekapazitäten hatte man ausgebaut. So konnte die Regierung rasch bestätigen, dass es sich um das Marburg-Virus handelte, und beim WHO-Zentrum in Nairobi medizinische Hilfsgüter anfordern, die binnen 72 Stunden eintrafen.
Arzneimittel und Impfstoffe lokal herstellen
Um Gesundheitsgefahren zu verringern, soll in Afrika auch die lokale Arzneimittelherstellung gesteigert werden. Die meisten Länder in Subsahara-Afrika importieren 70 bis 90 Prozent der von ihnen verbrauchten Medikamente, und nur etwa ein Prozent der dort verabreichten Impfstoffe wird auf dem Kontinent hergestellt. Die AU hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2040 60 Prozent der Impfstoffe für die Bevölkerung des Kontinents vor Ort hergestellt werden.
Ein Problem dabei: die Rechte an geistigem Eigentum. Zudem müssten große Pharmaunternehmen das Know-how für den Herstellungsprozess ihrer Produkte weitergeben, also Technologietransfer betreiben. Für afrikanische Hersteller ist es auch schwer, im Preiswettbewerb mit ausländischen Unternehmen mitzuhalten, besonders mit solchen in Ländern wie Indien, das einen dynamischen Generikasektor und den weltweit größten Impfstoffhersteller besitzt, das Serum Institute of India. Weiter müssen afrikanische Anbieter ihre Produkte einzeln bei den Regulierungsbehörden der afrikanischen Staaten registrieren lassen, was sehr mühselig ist, und sie haben selten ausreichenden Zugang zu erschwinglicher Finanzierung.
„Day Zero Financing“ unbedingt erforderlich
Erschwert wird Afrikas Handlungsfähigkeit gegen Epidemien auch von anderen Hindernissen auf globaler Ebene. Pandemievorbeugung und -bekämpfung zu finanzieren, ist für sie schwierig, sagt Javier Guzman, Direktor für globale Gesundheitspolitik am Center for Global Development. Es müsse sichergestellt werden, dass bei Ausbruch der nächsten Pandemie im Voraus zugesagte gebundene Mittel sofort zur Verfügung stehen; das wird als „Day Zero Financing“ bezeichnet. Vor allem die Weltbank muss laut Guzman noch Risikofonds bereitstellen, die unmittelbar abrufbar sind, wenn ein öffentlicher Gesundheitsnotstand ausgerufen wird.
Die Verhandlungen über ein globales Pandemieabkommen laufen noch. Für Fiona Braka ist von entscheidender Bedeutung, „dass die afrikanischen Stimmen bei diesen Verhandlungen gehört werden. Denn der Kontinent hat eine Fülle von Erfahrungen im Umgang mit Krankheitsausbrüchen in Gegenden, in denen die Ressourcen beschränkt sind“.
Aus dem Englischen von Anja Ruf.

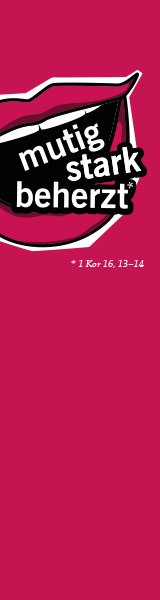
Neuen Kommentar hinzufügen