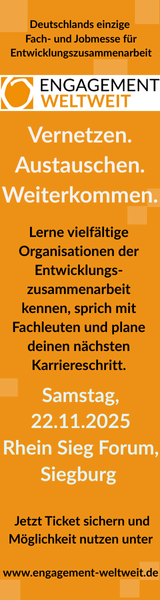Entwicklungsziele
Wie hat das Konzept der feministischen Entwicklungspolitik Deutschlands Entwicklungszusammenarbeit verändert? Der Gutachter Frank Bliss sieht Fortschritte, allerdings auch etliche Mängel bei der Verwirklichung des Konzepts.
Deutschland werde eine neue Nord-Süd-Kommission zur Bearbeitung globaler Probleme gründen, heißt es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Die Debatte darüber gewinnt an Fahrt. Manche meinen, schon der Name weise in die falsche Richtung.
In Sevilla haben die Staaten im Juli verhandelt, wie das für nachhaltige Entwicklung nötige Geld aufgebracht werden kann. Die USA fehlten, und auch ohne sie konnten die übrigen Länder nur einen ungenügenden Kompromiss finden.
Die Entwicklungsministerin skizziert, wie sie sich die künftige internationale Zusammenarbeit vorstellt. Dabei tappt sie in eine altbekannte Falle, kommentiert Tillmann Elliesen.
Brasilien hat in der G20 eine Allianz zur Überwindung von Hunger und Armut angestoßen. Sie kann viel bewirken, wenn die G20-Staaten das nötige Geld aufbringen, sagt Stig Tanzmann von Brot für die Welt.
Seit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) 2015 beschlossen wurden, wird diskutiert, wie realistisch sie sind und woran sich Erfolge messen lassen. Nun legt das das Brookings Institute eine differenzierte Zwischenbilanz vor.
Seit Monaten sieht sich die Entwicklungszusammenarbeit heftiger Kritik ausgesetzt, sie verpulvere deutsches Steuergeld im Ausland. Aus Sorge, solches Denken könnte in eigenen Reihen Zulauf gewinnen, argumentiert die Spitze der CDU/CSU-Fraktion nun dagegen.
Ein neuer Bericht für die UN-Generalversammlung zeigt den aktuellen Stand bei der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Danach dürften viele klar verfehlt werden.
EU-Hilfsprogramme, die Entwicklungsländer widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels machen sollen, haben nicht viel gebracht, kritisiert der Rechnungshof. Die EU-Kommission antwortet mit Verständnis und Argumenten.
Viele NGOs und größere Hilfswerke befassen sich derzeit mit der „Dekolonialisierung der EZ“. Das Problem ist nicht neu – und braucht vor allem konkrete Schritte statt abstrakter Theorien, meint Markus Brun.
Unterstützen Sie unseren anderen Blick auf die Welt!