Warum kommt BRAC nach Deutschland?
BRAC arbeitet schon lange mit der deutschen Regierung zusammen, etwa in Bangladesch mit der KfW Entwicklungsbank und der GIZ. Aber weil Deutschland ein so wichtiger Spieler in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist, wollen wir ein Stück weiter gehen und etwa im Bereich Klimaschutz und Armutsbekämpfung noch enger mit deutschen Entwicklungsagenturen kooperieren.
Was genau haben Sie vor?
Wir wollen unsere besonderen Kenntnisse und unsere Fähigkeiten als Entwicklungsorganisation aus dem globalen Süden und als eine der größten nichtstaatlichen Organisationen der Welt mit politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und der entwicklungspolitischen Community teilen. Ein Beispiel ist unser Ultra-Poor Graduation Approach, mit dem wir Armut auf unterschiedlichen Ebenen wie Ernährung, Bildung, Gesundheit und Einkommen gleichzeitig bekämpfen und das von den beiden Wirtschaftsnobelpreisträgern Abhijit Banerjee und Esther Duflo als sehr wirksam evaluiert wurde. Erkenntnisse aus dieser Arbeit können wir in Deutschlands entwicklungspolitischen Fokus auf soziale Sicherung einfließen lassen. Die Perspektive von BRAC ist einmalig und wird gebraucht. Es mangelt an einer Debatte, in der die Stimmen der Armen weltweit und ihrer Interessenvertretungen gehört werden.
Haben Sie außer zur Bundesregierung auch bereits Kontakt zur Szene nichtstaatlicher Entwicklungsorganisationen in Deutschland?
Ja, wir haben uns bereits mit ein paar führenden Organisationen und dem Dachverband Venro getroffen. Mit einigen, etwa der Christoffel-Blindenmission, haben wir früher schon kooperiert. Außerdem haben wir bereits deutsche Parlamentsmitglieder und andere Leute getroffen, die Einfluss auf die deutsche Entwicklungspolitik haben.
Sie wollen Perspektiven aus dem Süden in die deutsche Debatte bringen. Finden Sie, dass die in Deutschland zu kurz kommen?
Das kann ich im Detail nicht kommentieren. Aus Gesprächen mit Vertretern nichtstaatlicher Organisationen nehme ich aber mit, dass sie BRAC kennen und uns respektieren. Und sie denken, dass wir einiges Interessantes anzubieten haben, denn anders als andere Organisationen ist unsere Zentrale in einem Land des globalen Südens, von wo aus wir in elf Ländern in Asien und in Afrika arbeiten. Wir investieren in eine Art Meinungsführerschaft in Europa und in den USA und gehen damit gewissermaßen nicht den üblichen entwicklungspolitischen Weg von Nord nach Süd, sondern in die umgekehrte Richtung. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Aber deutsche Organisationen, etwa kirchliche, arbeiten eng mit Partnern im globalen Süden zusammen und bringen so deren Perspektiven nach Deutschland. Das reicht nicht?
Es ist ein anderer Ansatz. BRAC rekrutiert seine Teams aus den Gemeinschaften, die unmittelbar von extremer Armut betroffen sind. Wir sind der Ansicht, dass die Leute selbst am besten wissen, wie sie ihre Lage verbessern. Bei uns gibt es keine vermittelnden Organisationen dazwischen; wir haben direkten Zugang zu lokalen Lösungen. Das ist praxisnah, kostengünstig und flexibel.
BRAC arbeitet nicht mit lokalen Partnerorganisationen, sondern beschäftigt selbst lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Richtig. In der Regel arbeiten wir direkt und bieten unsere eigenen Dienste an. Dabei kooperieren wir mit anderen Organisationen, die das ergänzen, etwa mit Forschung oder technischer Unterstützung.
Wie passt dieser Ansatz zum Ziel, vor allem in der humanitären Hilfe, lokale Organisationen zu stärken und ihnen mehr Mitsprache bei der Verwendung von Hilfsgeldern zu geben?
Wir stehen leidenschaftlich hinter diesem Ziel. Wir kommen ja selbst aus dem Süden, so dass es sich bei unserem Engagement etwa in Afrika um eine Süd-Süd-Kooperation handelt, von der beide Seiten lernen. Wir sind der lebende Beweis, dass Lokalisierung richtig ist. Lokalisierung heißt für uns nicht nur, lokale Organisationen zu finanzieren. Für uns heißt es, direkt in die Gemeinschaften zu gehen, mit ihnen gemeinsam die Probleme zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten.
Und wie finanziert BRAC das?
Unser Vorteil gegenüber vielen anderen Organisationen ist unser gemischtes Finanzierungsmodell: Wir generieren 70 bis 80 Prozent unserer Einkünfte aus Sozialunternehmen und anderen Initiativen wie Mikrofinanzierung, die sich selbst tragen. Nur rund 20 Prozent stammen von Gebern wie Regierungen oder Stiftungen. Das gibt uns die Flexibilität, auf Bedürfnisse zu reagieren, die von den Gemeinschaften, mit denen wir arbeiten, identifiziert werden. Eine solche finanzielle Unabhängigkeit ist sehr selten im NGO-Sektor.
Sind die Sozialunternehmen, von denen Sie sprechen, Unternehmen der Gemeinschaften selbst, mit denen BRAC arbeitet?
Genau, und der Ursprung des Ganzen ist die Mikrofinanzierung. Durch sie bekommen die Armen die Möglichkeit, eigene Unternehmen aufzubauen. Manchmal müssen wir die Märkte schaffen, auf denen sie dann ihre Produkte verkaufen können. Mit Bäuerinnen in Bangladesch, die Viehzucht betreiben, haben wir zum Beispiel ein landesweites Unternehmen für Milchprodukte aufgebaut: BRAC Dairy ist eines der größten Sozialunternehmen in Bangladesch, dessen Ursprung in BRACs Programm für ländliche Entwicklung und für Mikrofinanzierung für Viehzüchterinnen liegt. Ein anderes Beispiel ist das BRAC-Sozialunternehmen für Saatgut, das aus dem Bedarf an klimaresilienten Pflanzensorten entstanden ist. Alle diese sehr erfolgreichen Unternehmen sind aus Entwicklungsprogrammen hervorgegangen. Die Profite, die sie generieren, fließen zur Hälfte für neue Investitionen in die Unternehmen zurück. Die andere Hälfte fließt in BRAC-Entwicklungsprogramme.
Sie sind davon überzeugt, dass der Kampf gegen Armut als profitorientiertes Geschäft geführt werden kann?
Nein, so einfach ist es nicht. Man braucht eine Mischung aus nicht profitorientierten und profitablen Ansätzen. Man braucht Investitionen, man braucht Mikrofinanzierung. Armut äußert sich derartig vielfältig, dass man verschiedene, evidenzbasierte Ansätze braucht, um Wirkung zu erzielen. Wir haben bislang 100 Millionen arme Menschen weltweit erreicht, unser Ziel sind 250 Millionen bis zum Jahr 2030. Da liegt also noch viel Arbeit vor uns.
Sie sagen, Mikrofinanzierung ist das Fundament der Arbeit von BRAC. Kritiker sagen, Mikrofinanzierung setze die Armen dem Spiel der Marktkräfte aus und mache sie abhängig von Finanzinstitutionen. Was sagen Sie dazu?
Ich kenne diese Kritik. Ich kann dazu nur sagen, dass wir ständig darauf achten, eine solche Abhängigkeit zu verhindern. Ich habe letztes Jahr ein Mikrofinanzprogramm in einem Dorf im Norden von Bangladesch besucht. Am meisten hat mich beeindruckt, dass dort drei oder vier Generationen in das BRAC-Programm integriert waren. Die Frauen und Männer, die Mikrokredite bekommen haben und mit denen ich gesprochen habe, sind nicht aufgetreten wie Leute, die irgendwie abhängig sind. Sie waren sehr engagiert und offen, sie hatten Pläne, einige hatten Kredite aufgenommen, damit sie ihre Kinder für die Digitalindustrien in der Hauptstadt Dhaka ausbilden können – und das auf dem Land im äußersten Norden von Bangladesch. Es ist ja gerade die Philosophie von BRAC, dass niemand abhängig sein, sondern auf eigenen Füßen stehen und die eigenen Pläne verfolgen soll.
Es gibt Berichte auch aus BRAC-Projekten, nach denen in Frauengruppen, die Mikrokredite erhalten, Druck auf Mitglieder ausgeübt wird, die ihre Kredite nicht bedienen können.
Davon weiß ich nichts. Aber natürlich lernen auch wir bei BRAC ständig dazu. Wenn solche Situationen auftreten, fragen wir uns: Wie ist das passiert? Was können wir ändern? Können wir vielleicht eine Versicherung oder ähnliches anbieten? Kundinnen von Mikrokrediten sind Risiken ausgesetzt, etwa als Folge des Klimawandels oder von Naturkatastrophen, und wir arbeiten daran, Sicherheitsnetze zu knüpfen, so dass sie nicht in schwierige Situationen kommen. Ohne Mikrokredite würde Bangladesch in punkto sozialer Entwicklung nicht da stehen, wo es heute ist. Zugleich ergänzen wir bei BRAC Mikrokreditprogramme mit Unterstützung etwa in der Berufsbildung, mit Gesundheitsdiensten und bedingungsloser Sozialhilfe. Das sorgt dafür, dass die Empfänger von Mikrofinanzierung arbeiten können und vorankommen, ohne die Kredite als Bürde zu empfinden.
Kann Armut beseitigt werden, ohne Strukturen in Politik und Wirtschaft zu ändern, die Armut verursachen und verfestigen?
Eine sehr gute Frage. Der politische Wille ist entscheidend. In diesen Tagen haben wir den 20. Jahrestag von Nelson Mandelas Rede in London zur „Make Poverty History“-Kampagne gefeiert. Dieser Aufruf an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gegen Armut an einem Strang zu ziehen, war für mich ein Meilenstein. Es ist einiges erreicht worden in Bezug auf UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 1, aber es ist unerlässlich, dass wir uns in politischen Foren weiter für ein gemeinsames Vorgehen gegen Armut einsetzen. Dass vor allem Stimmen aus dem Süden bei entwicklungspolitischen Entscheidungen mitreden können. Ich bin davon überzeugt, dass Ansätze wie unser Ultra-Poor Graduation Model genutzt werden sollten. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.
BRAC betreibt selbst aber keine politische Arbeit, oder?
Wir beschreiben uns selbst als Dienstleistungsorganisation. Wir betreiben keine Kampagnen wie andere nichtstaatliche Organisationen. Ich denke, das ist nicht unsere Stärke. Unser Angebot sind unsere Dienste in den insgesamt zwölf Ländern, einschließlich Bangladesch, in denen wir arbeiten. Zugleich lassen wir Entscheidungsträger und Geberorganisationen in Deutschland, Europa und der Welt an unseren Erfahrungen teilhaben, etwa in der G20-Allianz gegen Hunger und Armut, der wir angehören.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
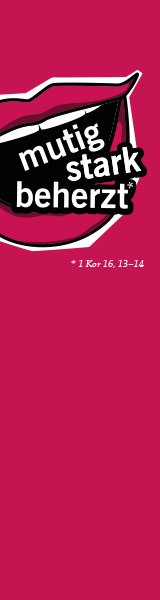
Neuen Kommentar hinzufügen