Die Fläche, über die sich die 32 Inseln und Atolle der Republik Kiribati erstrecken, ist so groß wie die der Vereinigten Staaten von Amerika. Anders als die USA könnte die Inselrepublik im Pazifik aber nach Einschätzung einiger Wissenschaftler in wenigen Jahrzehnten schon nicht mehr bewohnbar sein. Denn an ihrem höchsten Punkt liegt sie nur etwa drei Meter über dem Meeresspiegel, und der steigt.
Vor fünf Jahren hat der damalige Präsident von Kiribati, Anote Tong, für sein Land einen Plan der „Auswanderung in Würde“ entworfen. Er erwarb 20 Quadratkilometer Boden auf den südpazifischen Fidschi-Inseln, um dort im Ernstfall 115.000 Menschen aus Kiribati auf höherem Grund ansiedeln zu können. „Wenn es zur Katastrophe kommt, braucht mein Volk einen sicheren Zufluchtsort“, sagte Tong. „Ich strebe nach Auswanderung in Würde, wir wollen keine ‚Klimaflüchtlinge‘ sein – ein Ausdruck, der nicht genauer definiert ist und keinen Status im internationalen Rechtssystem beschreibt.“ Bis heute allerdings sind nur wenige Menschen tatsächlich umgezogen.
Für Tongs Nachfolger, den 2016 gewählten und im Juli 2020 wiedergewählten Präsidenten Taneti Maamau, ist es dagegen keine Option, Kiribati zu verlassen. Stattdessen verfolgt er den ambitionierten Plan, die Küsten der Inselrepublik zu verstärken – mit Hilfe von Aushub, der aus dem Meeresboden gebaggert werden soll. Auf diese Art, so die Vorstellung, könne sogar für die Landwirtschaft schon verlorener Boden wiedergewonnen werden. Die Inseln bestehen größtenteils aus Sand und Riff-Felsen und damit aus Materialien, die leicht erodieren.
Inseln müssen auf höheres Landniveau gebracht werden
„Bisher nahm man an, dass die niedrig gelegenen Inseln einfach im Meer versinken, sobald der Wasserspiegel steigt“, erklärt der kanadische Küsten-Geomorphologe Paul Kench, der Maamaus Regierung in Sachen Inselerhöhung berät. „Unsere Arbeiten in den letzten 20 Jahren an über tausend Inseln haben aber gezeigt, dass sich die Inseln in Größe und Form an Veränderungen des Meeresspiegels anpassen können.“ Seiner Beobachtung nach haben viele Inseln Kiribatis an Größe zugenommen und sind dabei, durch natürliche Prozesse an Höhe zu gewinnen – etwa dadurch, dass die Wellen Sand und Felsgestein anspülen und damit die Küste befestigen und auch erhöhen.
„Das betrifft aber größtenteils wenig besiedelte, kaum von Menschen veränderte Gebiete“, erläutert Kench. Das eigentliche Problem seien die wenigen dicht besiedelten, städtischen Inseln mit befestigten Küsten. „Sie müssten durch zusätzliche Gesteinsansammlungen unterstützt und gefestigt werden, um sie auf ein höheres Landniveau zu bringen.“
Diesen Ansatz findet Patrick D. Nunn, Professor für Geografie und Ozeanische Geowissenschaft an der australischen University of the Sunshine Coast, zu optimistisch. Er geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Inseln von Kiribati noch mehr als 20 Jahre lang bewohnbar bleibt. „Ich weiß, dass die Inseln über eine gewisse natürliche Widerstandsfähigkeit verfügen und beispielsweise zusätzliche Landschichten ansetzen können. Aber wir verstehen diese Prozesse noch viel zu wenig, um sie für uns nutzen zu können.“ So habe Paul Kench bei den „wachsenden“ Inseln nicht untersucht, was in deren Innerem geschehe, ob etwa das Inselzentrum auf gleicher Höhe bleibe oder absinke.
Kench räumt ein, dass sich lediglich an den Küsten zusätzliche Gesteinsschichten auf natürlichem Weg anlagern; „deshalb müssen wir Substanz aus dem Meeresboden baggern und wenn nötig im Zentrum der Inseln aufschütten“. Man könne der Gefahr künftiger Überflutungen entgegenwirken, indem man die natürliche Erhöhung der Inselränder unterstütze, so dass sie als Barriere dienen, wenn der Meeresspiegel ansteigt.
South Tarawa ist dichter bevölkert als Tokio
Einig sind sich Kench und Nunn darin, dass die Menschen auf den pazifischen Inseln genug von den Untergangsszenarien für ihre Heimatregion haben. Viele von ihnen betonen lieber die viel gerühmte Widerstandskraft, mit der sie schon zahlreiche Katastrophen überlebt haben. Sie erinnern beispielsweise an das Pukapuka-Atoll. Dort soll vor rund 400 Jahren eine gigantische Welle sämtliche Häuser, Felder und Gärten weggespült haben. Nur zwei Frauen und 17 Männer sollen am Leben geblieben sein und die Gemeinschaft von Pukapuka wieder aufgebaut haben.
Neben dem Anstieg des Meeresspiegels hat Kiribati in den vergangenen Jahren auch häufiger Dürren, heftige Stürme und extreme Springfluten erlebt – alles Ereignisse, die dem Klimawandel zugeschrieben werden. Das Krankenhaus der Hauptstadt South Tarawa auf der Hauptinsel wurde 2015 überflutet.
Mit einer Bevölkerung von 120.000 Menschen gehört Kiribati zu den Ländern mit den wenigsten Einwohnern. Allerdings lebt die Hälfte davon in South Tarawa, dessen Bevölkerungsdichte damit höher ist als die von Tokio, London oder Hongkong: Hier leben auf einem Quadratkilometer 15.000 Menschen. Carly Learson hat Anfang 2020 für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in Kiribati daran gearbeitet, die Inseln auf künftige Katastrophen vorzubereiten. Sie berichtet, der Verlust von Häusern infolge des Anstiegs des Meeresspiegels habe zur hohen Bevölkerungsdichte in South Tarawa beigetragen: Aus anderen Inseln kommen Menschen her. „Den Menschen stehen nur wenige Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung, der Abstand zwischen den Häusern beträgt manchmal nur Zentimeter.“ Wer Kiribati besuche, bekomme einen drastischen Eindruck davon, was Überbevölkerung für die seelische und körperliche Gesundheit bedeute. „Wenn einer eine Grippe oder Erkältung bekommt, steckt er gleich die ganze Nachbarschaft an.“
Eher die Jüngeren denken ans Auswandern
Claire Anterea, Einwohnerin von Kiribati und Mitgründerin des Klimaaktionsnetzwerks hier, wurde zur Aktivistin, als sie sah, wie sich der Klimawandel auf ihre Familie und ihre Freunde auswirkte. „Wir messen den steigenden Meeresspiegel inzwischen daran, wie viele Häuser bereits zerstört wurden.“ Aus ihrer Familie haben schon viele ihre Häuser zurückgelassen, weil sie von Fluten zerstört oder von Stürmen beschädigt wurden. Anterea hat den Eindruck, dass die Jüngeren eher ans Auswandern denken als die Älteren. Diese regten sich oft sehr auf und reagierten wütend auf den Vorschlag, beispielsweise nach Fidschi zu ziehen. „Die Familie bedeutet hier alles. Wir bleiben immer zusammen und teilen alles miteinander“, berichtet Anterea. „Außerdem bedeutet uns das Land sehr viel – wir haben hier unsere Ahnen begraben. Wir gehören hierher.“
2017, bei der 23. Konferenz zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 1992, präsentierte Staatschef Maamau wohlhabenden Investoren seine Idee, Kiribati zum „Dubai oder Singapur des Pazifiks“ zu machen, inklusive Fünf-Sterne-Bioresorts für Touristen, die „einzigartige Tauch-, Angel- und Surferfahrungen“ suchten. Bevor sich die Inseln derart verwandeln könnten, müssten sie allerdings erhöht und für Investitionen sicher gemacht werden, räumte Maamau ein. Dazu suche man auch Unterstützung aus China, erklärte er im Frühjahr 2020 gegenüber dem britischen „Guardian“ – trotz Bedenken und Protesten vonseiten Washingtons und seiner westlichen Verbündeten wegen des wachsenden chinesischen Einflusses in der Region.
"Es geht darum, eine Kultur zu retten"
Die Regierung von Kiribati hat noch nicht genauer benannt, wie sie das Projekt bezahlen möchte. Ihr kanadischer Berater Kench schätzt die Kosten auf eine halbe Milliarde US-Dollar und damit auf über das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts von Kiribati. „Aber es geht darum, eine Kultur zu retten. Wie können wir da eine finanzielle Obergrenze festlegen?“, sagt Kench. Zumal der Betrag nicht hoch sei, wenn man bedenke, wie viel Geld weltweit in allen möglichen Projekten versickere. „Das Inselerhöhungsprojekt ist mit der zur Verfügung stehenden Technik absolut machbar.“
Xi Jinping in Peking.
Das Projekt könnte der Hauptgrund dafür sein, dass sich Kiribati im September 2019 entschlossen hat, den diplomatischen Kontakt zu Taiwan abzubrechen und stattdessen diplomatische Beziehungen zu China aufzunehmen. China bot dem Land günstige Kredite und seine eigene Erfahrung mit dem Inselausbau im Südchinesischen Meer an. „Die chinesische Ingenieurskunst hat sich – gerade im Umgang mit knappen Budgets – als sehr geschickt erwiesen“, berichtet Nunn. „Da ist es kein Wunder, dass Kiribati dort Unterstützung sucht.“ Vonseiten Chinas erwartet der Geograf indes keine wirklich langfristige, nachhaltige Planung des Unterfangens: „Sie wollen vor allem kurzfristig Kiribati auf ihre Seite ziehen.“ Vor Maamaus Wiederwahl Mitte 2020 erhielt Kiribati aus Peking über 4,2 Millionen US-Dollar für „Lebensunterhaltsprojekte“. Wenige Monate später verteidigte Kiribati in einer Erklärung gegenüber den Vereinten Nationen die Internierung von über einer Million Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang.
Auch die USA streben nach Einfluss im Pazifik
Aber Kiribati kann sich nicht allein auf China verlassen; es müsse auf regionale Zusammenarbeit setzen, gibt Alexandre Dayant zu bedenken, der für die australische Denkfabrik Lowy Institute Auslands- und Entwicklungshilfe in der Pazifikregion untersucht. „Der größte Geber für Entwicklungsprojekte in Kiribati war von 2010 bis 2018 keinesfalls China, sondern Australien, Neuseeland, Taiwan, Japan und die Weltbank.“ Die Inseln zu erhöhen erfordere riesige Geldsummen, die China allein nicht aufbringen könne. Ohne weitere Geber werde es nicht gehen. „Angesichts der derzeitigen Spannungen zwischen den verschiedenen Pazifikstaaten ist ein Gemeinschaftsprojekt aber unwahrscheinlich.“
Dass China und die USA verstärkt um Einfluss auf die Region ringen, macht die Lage für die pazifischen Inseln noch schwieriger. Laut dem 2020 veröffentlichten Asia Power Index des Lowy Institute sind die USA noch immer das Land mit dem größten Einfluss, aber China liegt nicht mehr weit dahinter und legt deutlich zu. Auch militärisch bewertet der Asia Power Index die USA zwar nach wie vor als stärker, betont aber, dass China mit seiner Bevölkerungsstärke, seinen Ressourcen, seiner boomenden Wirtschaft und seinen wachsenden diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen für die Zukunft besser gerüstet sei.
Autor
Joshua McDonald
lebt in Melbourne und berichtet als freier Journalist über die Region Südpazifik. An dem Bericht hat Tuvshintugs Munkhbat in der Mongolei mitgearbeitet.Insel erhöhen und Umzugsmöglichkeiten schaffen
Mit oder ohne chinesische Hilfe – allein vom wissenschaftlichen Standpunkt aus hält Patrick Nunn es für sinnvoll, angesichts der hohen Kosten weiterhin über die Umsiedlung zu sprechen statt nur noch über Möglichkeiten der Inselaufschüttung. Den meisten Leuten sei durchaus klar, dass Pläne für eine Umsiedlung erforderlich seien, damit die Menschen umziehen können, bevor es zur Katastrophe kommt. „Eine kluge Migrationspolitik würde es den Menschen ermöglichen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, anstatt eines Tages überstürzt fliehen zu müssen“, heißt es auch in einem kürzlich veröffentlichten Papier des Kaldor-Zentrums für Internationales Flüchtlingsrecht der australischen Universität von New South Wales.
Paul Kench sieht die ideale Lösung in einem Kompromiss: Geberländer sollten Bauprojekte zur Erhöhung einiger Inseln, allen voran South Tarawa, bezuschussen, gleichzeitig mehr Infrastruktur auf sichereren Inseln Kiribatis schaffen und nicht zuletzt Umzugsmöglichkeiten in Drittstaaten wie Fidschi eröffnen. Dass es so kommt, hält er allerdings für unwahrscheinlich. „Diese Pläne durch alle politischen Gremien und Kanäle zu bekommen, ist unglaublich kompliziert.“
Die Klimaaktivistin Claire Anterea hofft indes, dass die verschiedenen Parteien das Projekt doch noch im Sinne Kiribatis unterstützen. Die meisten Einwohner seien für den Plan der Regierung, die Inseln zu erhöhen, anstatt auszuwandern. „Die Regierung will kämpfen, indem wir uns den Veränderungen anpassen, und irgendwie möchten das alle hier.“ Sie weiß, dass das Projekt viel Geld kostet, das die Regierung nicht hat, aber sie sieht keinen anderen Weg: „Wir müssen kämpfen.“
Aus dem Englischen von Barbara Erbe.
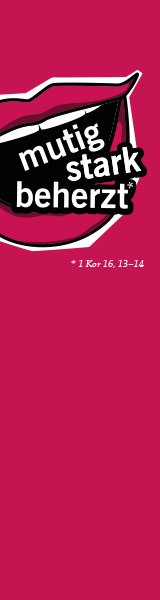
Neuen Kommentar hinzufügen