Im Juli haben die Vereinten Nationen die Lage in Somalia zur Hungersnot erklärt. Der Begriff wird offiziell selten gebraucht – ernste Umstände wie derzeit sind die Ausnahme. Und Regierungen scheuen dieses gefühlsgeladene Wort. Aber in Somalia haben die UN-Technokraten nun den Notstand ausgerufen, nicht aus einem Gefühl heraus, sondern auf der Grundlage profaner Daten über Sterbende und Hungernde.
Autor
Simon Levine
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Overseas Development Institute (ODI) in London. Zuvor war er mehrere Jahre für Hilfsorganisationen in Afrika tätig.Im ganzen Land sowie in Teilen Äthiopiens und Kenias stirbt das Vieh in großer Zahl, weil es kein Wasser und kein Weideland mehr gibt. Bis September wird es nicht regnen. Selbst wenn der nächste Regen gut ausfällt, wird sich die Lage bis Oktober auf jeden Fall noch verschlimmern. Zehntausende Kinder könnten sterben, während hunderttausende geschwächte Menschen in Flüchtlingslager strömen – auf der Suche nach Essen und medizinischer Hilfe. Tiere im Wert von hunderten Millionen Dollar werden verenden. Den Besitzern wird nichts bleiben, das ihnen helfen könnte, mit der nächsten Krise fertig zu werden, die unweigerlich kommen wird. Hilfsorganisationen bereiten sich vor, auf die Krise zu reagieren. Aber es ist viel zu spät, um mehr als die schlimmsten Symptome zu bekämpfen. Kühe und Kamele am Leben zu erhalten – und damit für Milch sowie Geld für Lebensmittel zu sorgen –, wäre viel billiger gewesen als jetzt unterernährte Kinder zu füttern. Aber als dafür noch Zeit war, wurde nur wenig unternommen.
Mitgefühl ist die erste Antwort auf die Situation in Somalia und seinen Nachbarländern. Aber es darf nicht bei Trauer und Mitleid bleiben. Ein gewisses Maß an Wut ist ebenso angebracht – und ein stures Festhalten daran, dass solche Notlagen nicht zugelassen werden dürfen. Berichte in den Medien sind einerseits hilfreich, weil sie zu der dringend erforderlichen Hilfe animieren. Sie können andererseits aber auch die Wut dämpfen, denn zu oft wird der Hunger mit einer Dürre erklärt. Und wem, außer vielleicht Gott, sollte man die Schuld für einen Mangel an Regen oder andere Naturkatastrophen geben? Natürlich spielt es eine Rolle, dass es nicht regnet. Aber die Menschen sterben nicht allein deshalb, ja nicht einmal ihre Tiere verenden, nur weil es nicht regnet. Die Viehhirten in den Trockengebieten am Horn von Afrika können mit den wiederkehrenden Dürren an sich gut umgehen, indem sie mit ihren Tieren über das Land ziehen, auf der Suche nach neuen Wasserquellen und frischen Weiden. Hungersnöte gibt es bei den Pastoralisten nur dann, wenn sie noch andere Probleme haben.
Das größte Problem in Somalia ist der seit zwanzig Jahren dauernde Bürgerkrieg, der die Wirtschaft zerstört hat und die Überlebensstrategien der Bevölkerung untergräbt. Bei der Hungersnot 1984 in Äthiopien wird heute ebenfalls häufig an eine Dürre gedacht. Aber auch sie war in Wahrheit die Folge eines langen Bürgerkriegs, der die Fähigkeit der Leute zerstört hatte, mit einer weiteren Trockenperiode fertig zu werden. Der Konflikt in Somalia hat außerdem die Wanderwege der Viehhirten zerschnitten, so dass sie die verbleibenden Weiden und Wasserquellen nicht erreichen.
Weitere Ursachen reichen noch tiefer. Pastoralisten geraten in die Krise, wenn Regierungen ihnen verbieten, über das Land zu wandern, das sie speziell in Trockenzeiten benötigen – zum Beispiel weil auf ihren Weidegründen Pflanzen angebaut und bewässert werden oder das Land an Investoren verpachtet wurde. Dabei ist längst entschieden: Die nomadische Viehwirtschaft ist viel besser geeignet für das trockene Weideland und produktiver als bewässerte Landwirtschaft.
Krisen entstehen aber auch dadurch, dass in Gegenden, die während Dürren als Weideland dienen, unkontrolliert Wasserquellen angelegt werden, die zu viele Hirten und ihr Vieh anlocken. Oder dadurch, dass Regierungen die Grenzen schließen, den Handel unterbinden und als Folge die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Oder dadurch, dass Nahrungsmittelhilfe – die in Notsituationen dringend gebraucht wird – aus politischen Gründen jahrein, jahraus weiter gegeben wird, die Selbsthilfekräfte der Empfänger schwächt und dazu führt, dass sich Leute in Gegenden ansiedeln, in denen sie sich nicht selbst ernähren können. Krisen entstehen, weil Regierungen die Wirtschaft der Pastoralisten nicht fördern und den Handel mit Vieh behindern, weil sie fürchten, ihnen könnten Steuereinnahmen durch die Lappen gehen. Krisen treffen Bürger, die von ihren Regierungen missachtet werden.
Wut ist auch deshalb angebracht, weil Hungersnöte entstehen, wenn Hilfe nicht rechtzeitig ankommt. In Teile Somalias und dem Süden Äthiopiens haben Hilfsorganisationen wegen der Konflikte dort keinen Zugang. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Dürren und Krisen am Horn von Afrika gab es bereits 1999/2000, 2002/2003, 2005/2006 sowie 2008/2009 – und jedes Mal war die Reaktion gleich: spät und unangemessen. Jedes Mal gab es etliche Warnsignale – auf die gegenwärtige Krise bereits vor einem Jahr. Doch Regierungen und Hilfsorganisationen haben auch dieses Mal wieder gewartet, bis sie Millionen unterernährter Kinder gesehen haben – und erst dann auf die unausweichliche Logik der sich zuspitzenden Krise reagiert. Das System der humanitären Hilfe springt auf die falschen Signale an: Wir reagieren auf Unterernährung, die erst dann auftritt, wenn die Leute nichts mehr zu essen haben. Es muss aber schon dann etwas getan werden, wenn sich abzeichnet, dass die Nahrung knapp wird.
Doch für derart rechtzeitige Hilfe müssen viele Kräfte zusammenwirken, und wir wissen längst, dass die Regierungen der betroffenen Länder, die Geber, die Vereinten Nationen und andere Organisationen unfähig dazu sind. Wir wissen genau, warum, und wir wissen, was eigentlich nötig wäre: langfristige Strategien, die auf flexiblen Hilfsprogrammen ruhen, die es erlauben, den Kurs zu ändern, wenn sich die Lage ändert, sowie Nothilfe mit dem Ziel, die Viehwirtschaft der Pastoralisten am Leben zu erhalten, so dass die Hirtenfamilien sich selbst ernähren können. Diese Strategien müssen auf der Bewegungsfreiheit aufbauen, die die Viehhirten brauchen, statt sie zu behindern.
Die Hungersnot am Horn von Afrika wird in den nächsten Monaten noch schlimmer werden. Das lässt sich nicht ändern, aber das macht sie noch lange nicht zur „Naturkatastrophe“. Der Regenmangel hat Mensch und Tier in der Region den Rest gegeben – aber nur weil beide schon vorher von der Politik und der internationalen Hilfe sträflich vernachlässigt und als Folge unerträglich belastet wurden. Als Mitglieder der Entwicklungshilfe-Gemeinschaft haben wir nur wenig Einfluss auf die Politik. Wir können und sollten aber versuchen, die Hilfe zu verbessern. Ist die Wut groß genug, dass wir es dieses Mal wirklich versuchen?
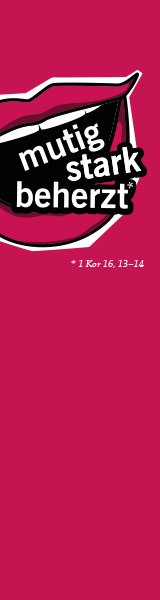
Neuen Kommentar hinzufügen