Welche konkreten Probleme wollen Sie angehen?
Wir haben zuletzt zu stark in voneinander getrennten Bereichen gedacht. Die Pandemie hat das nochmal gezeigt: In vielen Ländern gab es gute Maßnahmen zur Eindämmung von Corona. Wir hatten aber keine Politik, wie die Ernährungssysteme und Landwirte mit den Lockdowns umgehen.
Wo sehen Sie derzeit die größten Herausforderungen beim Kampf gegen den Hunger?
Es gibt viele große Herausforderungen, etwa den Klimawandel. Wenn ich ein Thema herauspicken müsste: Wir sehen, dass Armut und Hunger vor allem in Staaten mit schwachen Regierungen und Konflikten zunehmen. Wir haben noch nicht den richtigen Werkzeugkasten, um in solchen Ländern langfristig für Entwicklung sorgen zu können, anstatt nur humanitäre Hilfe zu verteilen. Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung wird in Zukunft versuchen, Entwicklungsprojekte in fragilen Kontexten widerstandsfähiger zu machen. Das kann langfristig auch für Frieden sorgen, weil Warlords, die über Hunger und Armut die Bevölkerung radikalisieren, der Wind aus den Segeln genommen wird.
Im ersten Jahr der Corona-Pandemie ist die Zahl der Hungernden auf 811 Millionen Menschen gestiegen, knapp zehn Prozent der Weltbevölkerung. Wie müssen Ernährungssysteme in armen Ländern umgebaut werden, damit sie besser mit Ereignissen wie der Pandemie zurechtkommen?
Es geht im Wesentlichen um die Lieferketten. Zum einen müssen Bäuerinnen und Bauern auch bei Lockdowns an Saatgut und Dünger kommen. Zum anderen müssen sie ihre Produkte zum Endverbraucher oder Zwischenhändler bringen können. Das klingt erstmal einfach. Aber nach allem, was wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, ist das nicht trivial. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden viele Kleinbauern und Zwischenhändler aufgeben und landwirtschaftliche Flächen nicht mehr genutzt. Das würde den Hunger verstetigen und verschlimmern.
Waren lokale Ernährungskreisläufe in Zeiten der Pandemie robuster als globale Lieferketten?
In Teilen, ja. Der Verkehr wurde ja überall erstmal international beschränkt und erst später auch national. Je lokaler die Produktion, desto besser. Dazu gehört auch, die weitere Verarbeitungsschritte, etwa das Verpacken in Konserven, möglichst in der Anbauregion anzusiedeln. Die Welternährungspolitik hat in den vergangenen Jahren nur auf die Kalorienproduktion geschaut. Wir haben zu wenig überlegt, wie ländliche Gebiete so entwickelt werden können, dass dort nicht nur angebaut, sondern auch weiterverarbeitet wird. Das würde die Anbauregionen, in denen es häufig eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, wirtschaftlich beleben. Zudem würden weniger Nahrungsmittel verderben, wenn sie vor Ort verarbeitet würden.
Ihre Organisation unterstützt und berät Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in armen Ländern. Welche Rolle spielen sie bei der Ernährung der Weltbevölkerung?
In Afrika produzieren Kleinbäuerinnen und Kleinbauern etwa 80 Prozent der Lebensmittel für die Bevölkerung - obwohl es in Afrika auch große Agrarkonzerne gibt. Sie verbrauchen zudem am wenigsten CO2 pro produzierter Einheit und sind naturnäher sowie nachhaltiger. Mich verblüfft immer wieder, dass kleine Farmen in Afrika auch höhere Hektar-Erträge als industriell produzierende Betriebe haben. Ihre Böden laugen weniger aus, weil sie die Sorten stärker durchwechseln. Es hängt aber auch mit den Anbauformen zusammen: Manche Landwirte pflanzen beispielsweise unter ihren Obstbäumen nochmal Kakao- und Kaffeepflanzen, die den Schatten der Bäume brauchen. Gleichzeitig sind die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vom Klimawandel besonders stark betroffen und bekommen kaum Geld, um sich anzupassen.
Wie können sie gestärkt werden?
Es fehlt am Geld. Wir bräuchten pro Jahr 300 bis 350 Milliarden Euro für die ländliche Entwicklung. Das Geld kann unmöglich alleine aus der staatlichen Entwicklungshilfe kommen, da müssen auch Entwicklungsbanken einsteigen.
Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren, dass die Agrarindustrie zu viel Einfluss auf die Agenda des Treffens hat und boykottieren den Gipfel. Teilen Sie die Kritik?
Nein, die teile ich nicht. Es gab in 145 Ländern nationale Dialoge, die sehr breit waren, auch mit der Zivilgesellschaft, Kleinbauern und indigenen Gruppen.
Aber ein gewisser Interessensgegensatz zwischen der Agrarindustrie und einer ökologisch-nachhaltigen Landwirtschaft ist ja nicht von der Hand zu weisen. Zum Beispiel nutzen Agrarkonzerne riesige Flächen für den Anbau von Soja für die Viehzucht. Was können Agrarunternehmen überhaupt zum Aufbau ökologischer und gerechter Ernährungssysteme beitragen?
Ein Konzern denkt immer auch - und manchmal nur - profitorientiert. Die größte Macht haben die Konsumentinnen und Konsumenten. Es gibt immer mehr Menschen, die bei der Ernährung Rücksicht auf ökologische Aspekte nehmen und zum Beispiel aus Umweltgründen kein Fleisch mehr essen. Auch ein rein profitgetriebener Konzern wird irgendwann eine Sparte aufbauen, die dieses wachsende Segment der Gesellschaft bedient. Regierungen könnten natürlich noch zusätzliche finanzielle Anreize schaffen.
Welches Signal erhoffen Sie sich von dem Gipfel?
Nach der Corona-Pandemie werden viele Länder erstmal sparen. Das Signal muss sein: Ihr könnt sparen, aber nicht beim Budget für die Entwicklungszusammenarbeit und schon gar nicht im Bereich der Ernährungssicherung. Das gilt nicht nur für Geberländer, sondern auch für Staaten, in denen es noch Mangelernährung gibt. Nicht alle investieren ausreichend im Agrarbereich. Auch diese Länder sind gefragt, die Kleinbauern nicht alleine zu lassen. Das betrifft wirklich alle.
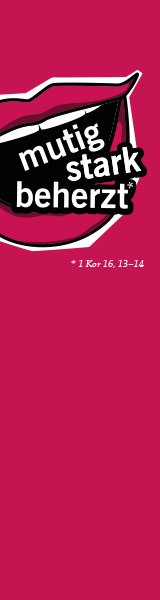
Neuen Kommentar hinzufügen