Jahrelang hatte Katra Abii davon geträumt, mit ihrer Familie nach Somalia zurückzukehren. Acht Kinder hatte sie im kenianischen Flüchtlingslager Dadaab zur Welt gebracht. Eines Tages, so hoffte sie, würden ihre Söhne und Töchter in ihrem Heimatland Familien gründen. Doch solange die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia Menschen ermordete, um die schwache Regierung zu Fall zu bringen, wollte sie mit den Kindern in Dadaab bleiben. In dem weltgrößten Flüchtlingslager waren inmitten einer unfruchtbaren Wüste mehr als 300.000 Menschen untergebracht.
Im Mai gab die kenianische Regierung bekannt, dass sie das Lager auflösen will – Al-Shabaab-Milizen hätten es infiltriert. Unter dem Druck Nairobis erklärte sich das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bereit, die Ausreise rückkehrwilliger Somalier zu beschleunigen, und schon bald wurden täglich bis zu 1000 Menschen nach Somalia zurückgebracht.
Doch laut Abii läuft bei diesem Programm nichts freiwillig. Sie stimmte der Rückreise nach Somalia im August nur zu, weil ihr klargemacht wurde, dass Kenia am Ende alle Bewohner des Lagers mit Gewalt vertreiben würde. Und sie wusste, dass keine Zeit bleiben würde, die bescheidenen finanziellen Hilfsangebote des UNHCR in Anspruch zu nehmen, wenn die kenianische Armee erst einmal angefangen hätte, Flüchtlinge zwangsweise zu deportieren. Das hatte das Militär nach einer Serie von Terroranschlägen 2014 schon einmal getan.
Leben im Abfall
Und so beschloss Abii, mit ihren Kindern in die somalische Hafenstadt Kismayo umzusiedeln – obwohl sie wusste, dass es keine glückliche Heimkehr sein würde. Die versprochene Hilfe – medizinische Versorgung, Schulunterricht, Zuschüsse zu Lebensmitteln – blieb aus oder erwies sich als völlig unzureichend. Die Familie kam in ein Lager für somalische Binnenflüchtlinge, die es nicht über die Grenze nach Kenia geschafft hatten. Ihr neues Zuhause in einer improvisierten Hütte auf einem von Abfällen übersäten Strand hatte mit dem alten in Dadaab einiges gemeinsam. Allerdings war es weniger sicher, und nur wenige Hilfsorganisationen kümmerten sich um sie.
Der UNHCR hat seit Dezember 2014 die Ausreise von mehr als 24.000 Flüchtlingen organisiert; angeblich waren alle einverstanden. Dann wurde das Verfahren beschleunigt, um den Zeitplan der Kenianer für die Auflösung des Lagers Dadaab einzuhalten. Zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Repatriierung ist kein Unterschied mehr zu erkennen. Offenbar unterstützt der UNHCR ein Verfahren, das gegen die Grundregel des Flüchtlingsrechts verstößt: Geflüchtete und Asylsuchende dürfen nicht gegen ihren Willen in ein Land abgeschoben werden, in dem sie mit Verfolgung rechnen müssen.
Gespräche mit Betroffenen wie Katra Abii liefern Hinweise, dass sie gegen ihren Willen zurückgeschickt wurden. Damit bestätigt sich der Verdacht, dass eine Abschiebungskampagne im Gange ist. „Diese Menschen werden hierher verfrachtet ohne internationale Unterstützung und ohne Perspektive, wie für sie gesorgt werden soll“, sagt der Bürgermeister von Kismayo, Ibrahim Mohammed Yusuf. „Es gibt weder Unterkünfte noch Lebensmittel, Gesundheitsversorgung oder Schulen.“ Somalia sei ein kleines Land, das einen Bürgerkrieg erlebt hat. „Schon jetzt sterben die Leute hier, weil sie nicht ausreichend medizinisch versorgt werden. Wie können wir da noch mehr Menschen aufnehmen?“
Das UNHCR färbt die Sicherheitslage schön
Der Krieg in Somalia ist noch nicht zu Ende. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union hat zwar die Al-Shabaab-Milizen aus den meisten Städten vertrieben. Doch in der Mitte und im Süden des Landes können die mit Al-Qaida verbündeten Rebellen nach Belieben operieren. Schon vor der Rückkehr von Flüchtlingen aus kenianischen Lagern mussten in Somalia mehr als eine Million Binnenvertriebene untergebracht werden, die ihre Heimatorte wegen der Kämpfe oder wegen der anhaltenden Dürre verlassen hatten. In der Mehrzahl leben sie in überfüllten Lagern am Rand der größeren Städte. Damit sie dort nicht von Rebellen und Banditen überfallen werden, müssen sie Schutzgeld an selbst ernannte Wachposten zahlen.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk bezeichnet gewisse Teile des Landes, darunter Kismayo, als sicher genug für die Rückführung von Flüchtlingen. Dabei erkennen die UNHCR-Experten selbst dies als Wunschdenken. Die Zivilbevölkerung leide weiter schwer unter dem Konflikt, heißt es in einem Bericht von Mai 2016. Noch immer würden Zivilisten verwundet und getötet, sexuelle und andere Gewalttaten an Frauen und Kindern seien weit verbreitet. Junge Heimkehrer ohne Hoffnung auf Arbeitsplätze und soziale Absicherung sind leichte Beute für die Al-Shabaab-Milizen. „Es ist nicht auszuschließen, dass manche bereit sind, sich den Extremisten anschließen“, sagt Ahmed Nur, Leiter der somalischen Flüchtlingsbehörde.
Nur schätzt, dass bereits zehn Prozent der Rückkehrer nach Mogadischu in den Lagern für Binnenflüchtlinge leben. In Kismayo liegt der Anteil derer, die keinen Wohnsitz mehr haben, eher bei 15 Prozent, sagen Mitarbeiter der UN und anderer Hilfsorganisationen. Laut den Verwaltungsbehörden der Region drängen sich die Rückkehrer aus Dadaab in den 86 Lagern für Binnenflüchtlinge, die über das ganze Stadtgebiet verstreut sind.
Im Camp Tawfiq reihen sich Hütten und Zelte aus alten Getreidesäcken und anderem Behelfsmaterial zu Dutzenden auf den gelben Sanddünen am Meer. 60 der 200 Familien, die hier kampieren, kommen aus Dadaab. „Hier ist es schlimmer als in Dadaab. Es gibt kein Trinkwasser und keine Kanalisation“, sagt Ahmed Mohammed Abubakar, der im Jahr 2009 vor den Kämpfen in Kismayo geflüchtet war. Dieses Jahr ist er samt seiner Familie mit Hilfe des UNHCR zurückgekommen. „Dies ist mein Land, aber für mich gibt es hier nichts. Ich habe keine Wohnung und bin heimatlos.“
Angst vor dem Militär
Die Rückkehrer berichten, sie seien unter Druck gesetzt worden, Dadaab zu verlassen. Die kenianischen Sicherheitskräfte hätten gezielt Gerüchte über bevorstehende Zwangsrückführungen gestreut. Sie fürchteten sich vor gewaltsamen Übergriffen, falls sie das Camp nicht rechtzeitig verlassen würden. Die Führer ihrer Gemeinschaften in Dadaab hätten ihnen mit Bestimmtheit gesagt, die kenianischen Behörden würden sie nicht länger bleiben lassen. Dass kenianische Generäle in den Regierungsausschuss berufen wurden, der die Auflösung des Lagers organisieren sollte, fassten sie als unmissverständliches Warnsignal auf: Die Regierung wollte das Lager zum 30. November schließen. Wer dann noch dort wäre, würde vom Militär mit Gewalt vertrieben.
Die Hilfsorganisationen konnten nicht sagen, was nach Ablauf der Frist geschehen würde, und sie taten wenig, um die Menschen im Lager zu beruhigen. Außerdem waren die Ernährungshilfen des UN-Welternährungsprogramms (WFP) schon 2015 um ein Drittel gekürzt worden. Im Nachhinein sahen manche darin die verdeckte Absicht, die Flüchtlinge auf Hungerrationen zu setzen und sie so zum Abzug zu bewegen. „Wir hatten keine Wahl als das wenige Geld zu akzeptieren, das man vom UNHCR bei der Ausreise bekam. In Dadaab gab es nicht mehr genug zu essen“, erklärt Abubakar.
Laut Mark Yarnell, der sich als Anwalt der Menschenrechtsorganisation Refugees International für die Somalier einsetzt, verstößt ihre Rückführung eindeutig gegen internationale Prinzipien und Vereinbarungen. „Es ist eine Farce, die Ausreise freiwillig zu nennen, wenn die Kenianer eine Einschüchterungskampagne inszenieren und der UNHCR Anreize schafft, um die Somalier zur Rückkehr in ihr instabiles und unsicheres Land zu motivieren“, sagt er.
Das kenianische Innenministerium hat auf mehrfache Anfragen nicht reagiert. In der Vergangenheit wurde stets bestritten, dass die Rückführungen unfreiwillig sei. Doch wiederholt umgingen die zuständigen Beamten die Frage, was mit denen geschehen soll, die bleiben wollen. Haro Kamau, der für Dadaab verantwortliche Verwaltungsbeamte des Garissa County, sagte im Juli, es wäre „sehr rücksichtlos von den Flüchtlingen, wenn sie nicht gehen würden“.
Der UNHCR behauptet weiter, es nehme die Repatriierungen gemäß seinem politischen und moralischen Auftrag vor: Die Freiwilligkeit und Sicherheit der Ausreise seien gewährleistet und es werde dafür gesorgt, dass die Menschenwürde der Flüchtlinge gewahrt bleibt. Man räumt zwar ein, dass Menschenrechtsanwälte Kritik geäußert hätten. Der UNHCR arbeite jedoch eng mit der kenianischen Regierung zusammen, um sicherzustellen, dass die Rechte der Flüchtlinge nicht verletzt werden.
„Der UNHCR drängt die Flüchtlinge nicht zur Rückkehr, aber es unterstützt diejenigen, die eine wohlüberlegte und freiwillige Entscheidung zugunsten der Ausreise getroffen haben“, erklärt Catherine Hamon Sharpe vom UNHCR in Kenia. „Wir organisieren Transporte und gewähren finanzielle Hilfen und Sachleistungen. Natürlich sind die Flüchtlinge darüber beunruhigt, dass die Regierung Kenias mit dem 30. November eine Frist für die Schließung des Lagers gesetzt und keine Alternativen angeboten hat, denn eine freiwillige Rückkehr kann zeitlich nicht befristet werden. Doch bekanntermaßen hat die Regierung mehrfach versprochen, dass es keine Zwangsrepatriierung geben wird.“
Die widersprüchliche Aussage, eine freiwillige Rückkehr könne nicht befristet werden, die gegenwärtigen befristeten Ausreisen würden jedoch völlig freiwillig unternommen, macht deutlich, dass sich der UNHCR in eine unhaltbare Position manövriert hat. Unter vier Augen räumen derzeitige und ehemalige Mitarbeiter ein, die kenianische Regierung habe sie vor eine unmögliche Wahl gestellt. Die Kenianer hatten die Auflösung des Lagers beschlossen. Ohne die Mitwirkung des UNHCR hätten sie möglicherweise Massendeportationen veranlasst. Das hätte zu einer humanitären Katastrophe führen können. Doch genauso nennt die Regionalregierung von Jubaland, die für Kismayo zuständig ist, das Rückführungsprogramm des UNHCR.
Selbst wenn es dem UNHCR gelingen sollte, das Schlimmste zu verhindern: Seine Aktivitäten liefern der kenianischen Regierung, der die Flüchtlinge schon lange ein Dorn im Auge sind, ein politisches Alibi. Und je mehr Panik unter den Flüchtlingen verbreitet wird, desto deutlicher wird es, dass der UNHCR die internationalen Prinzipien verrät, für die es sich einsetzen sollte. Jeff Crisp, ein ehemaliger UNHCR-Stratege, der jetzt für das Refugee Studies Center der Universität Oxford arbeitet, wirft der Organisation vor, sie sei unehrlich. Wenn sie sich an einer Aktion beteilige, die gegen ihre eigenen Grundsätze verstoße, müsse sie deutlich machen, was sie tue und warum. „Aber in den vergangenen Wochen habe ich den Eindruck gewonnen, dass man alles zu vertuschen versucht“, sagt Crisp.
Die Rückkehrer fühlen sich getäuscht
Es wird nicht nur verschleiert, dass Flüchtlinge offenbar gegen ihren Willen repatriiert werden. Der UNCHR beschönigt auch das gefährliche Umfeld für die Heimkehrer sowie seine begrenzte Kapazität, ihnen zu helfen. Abubakar und andere Flüchtlinge aus Dadaab beklagen sich, dass die Hilfsorganisationen sie im Stich lassen. Sie hatten erwartet, dass sie mehr tun würden, als ihnen die Rückkehr in ihre zerstörte Heimat zu erleichtern. „Der UNHCR hat uns Unterkünfte und Schulen für die Kinder versprochen“, sagte Abubakar, der früher in einem kleinen Betrieb in der Stadt beschäftigt war. „Wir sind hierher gekommen und es ist nichts da. Die Versprechen wurden nicht gehalten.“
Manche Rückkehrer berichten, sie seien über die Sicherheitslage in ihren Heimatregionen falsch informiert worden. Erst bei ihrer Ankunft in Kismayo erfuhren sie, dass die Dörfer, aus denen sie stammen, noch immer von Al-Shabaab kontrolliert werden. Alle erklärten, sie hätten zu wenig zu essen, und die finanzielle Unterstützung reiche nicht aus. Der UNHCR hatte ihnen eine einmalige Rückkehrhilfe von ein paar hundert US-Dollar pro Haushalt ausgezahlt. Zusätzlich bekamen sie für das erste halbe Jahr monatlich noch einmal 200 Dollar, einzulösen mit einer Lebensmittelkarte des WFP.
Autor
Ty McCormick
ist Afrika-Redakteur der US-amerikanischen Zeitschrift „Foreign Policy“. Dort ist sein Beitrag im Original erschienen.Seit Ende August lässt die Regionalregierung von Jubaland keine Neuankömmlinge aus Dadaab mehr über die Grenze. Sie will keine weiteren mehr akzeptieren, bis der UNHCR und andere Hilfsorganisationen nicht zumindest ein Minimum an Hilfe gewährleisten können. Derzeit verhandeln die Regionalregierung, Nairobi und der UNHCR über die Wiederaufnahme der Rückführungen nach Kismayo. Unterdessen bringen Flugzeuge mehrmals pro Woche Flüchtlinge aus Dadaab nach Mogadischu. In Dadaab hatten sie es nicht leicht, aber die Hilfsorganisationen im Lager sorgten für eine gewisse Sicherheit. Jetzt müssen sie unter sehr viel härteren Umständen und mit viel weniger Unterstützung ein neues Leben anfangen. Sie tun es offenbar überwiegend gegen ihren Willen. Das verstößt gegen das Völkerrecht.
Aus dem Englischen von Anna Latz.

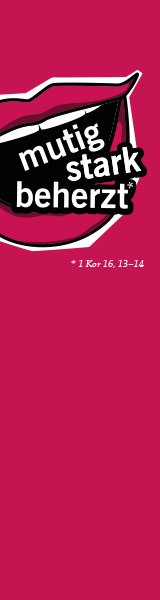
Neuen Kommentar hinzufügen