Als Brückenbauer hatte sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Beginn der halbjährigen EU-Ratspräsidentschaft inszeniert. Sein Programm unter dem Motto „Ein Europa, das schützt“ weist drei Schwerpunkte aus: Sicherheit und der Kampf gegen illegale Migration, Sicherung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und Stabilität in der Nachbarschaft sowie Heranführung des Westbalkans an die EU. Die Bilanz fällt knapp zwei Monate vor dem Ende des Ratsvorsitzes bescheiden aus.
In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage verweist Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) auf die Trendwende in der europäischen Migrationspolitik, die am 20. September auf dem Gipfel in Salzburg stattgefunden habe. Dafür stehe „insbesondere der verstärkte Fokus auf den Außengrenzschutz, die Stärkung von Frontex sowie die Intensivierung der Partnerschaft mit Afrika auf Augenhöhe“.
Die Opposition kam im Oktober zu einer anderen Einschätzung. „Technisch okay, politisch ein Desaster“, urteilte die EU-Abgeordnete der liberalen NEOS Angelika Mlinar. Sie müsse sich im EU-Parlament ständig für die Politik ihrer Regierung „rechtfertigen“. Die SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner sprach von „vielen schönen Überschriften und viel PR-Show“. Wenn die Regierung vom Brückenbauen redet, sei das „eher ein Brückeneinreißen.“
Stark auf nationalen Interessen gerichtet
Auch die Außensicht ist kritisch. Peter Žerjavič, EU-Korrespondent der slowenischen Tageszeitung „Delo“ kommentiert zur Migrationspolitik: Das neue Paradigma, das nur auf dem Schutz der Außengrenzen basiere sei „nicht ausreichend“ für einen besseren Umgang mit Migration. Stephan Israel vom Zürcher „Tagesanzeiger“ schreibt, man habe bisher nicht den Eindruck, Kurz versuche ernsthaft, Gräben zu überwinden. Österreichs rechtsnationale Regierung scheine „vor allem ihre eigene Migrationsagenda mit dem engen Fokus auf Abschottung voranzutreiben.“ Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erinnert sich in einem Interview mit dem Magazin „profil“ an keine EU-Präsidentschaft, „die den Fokus so stark auf ihre nationalen Interessen richtete wie derzeit die österreichische. Das ist sehr enttäuschend.“
Durch den Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt auf Druck der FPÖ hat Österreich sich als Mittler und Brückenbauer aus dem Spiel genommen. Das sehen selbst in der ÖVP viele so, allen voran der EU-Delegationsleiter Otmar Karas. „Dieser Pakt ist von uns mitverhandelt und in unserem Interesse“, sagte er Mitte November in Straßburg. Applaus kam nur von der extremen Rechten für eine Regierung, die sich zunehmend im Lager der Visegrád-Staaten positioniert. Diese verweigern jede Kooperation im Umgang mit Migrantinnen und Migranten.
Treffen wurden kurzfristig abgesagt
Ausgerechnet während der EU-Ratspräsidentschaft wurde zudem die Kürzung der Familienbeihilfe durch das Parlament geboxt: Arbeitsmigrantinnen aus anderen EU-Ländern, die ihre Kinder zurücklassen mussten, werden künftig eine geringere Beihilfe auf dem Niveau ihres Heimatlandes erhalten. Die rechtspopulistische Regierung zog das Projekt durch, obwohl sie damit rechnen muss, dass die Regelung vor der EU nicht halten wird.
Ein für Oktober geplantes Treffen der Sozialminister, bei dem die Pläne für eine Europäische Arbeitsagentur konkretisiert werden sollten, wurde kurzfristig abgesagt. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein signalisierte das Desinteresse ihrer Regierung an einer EU-Agentur, die sich darum kümmert, dass die Bestimmungen über die grenzüberschreitende Freizügigkeit von Arbeitnehmern eingehalten werden. „Österreich braucht das nicht unbedingt“, erklärte sie.
Der große Afrika-Gipfel am 18. Dezember in Wien wurde zuerst ganz abgesagt, dann auf ein „High Level Forum“ zurückgestuft. Außer dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Ruandas Präsident Paul Kagame, habe sich kein afrikanisches Staatsoberhaupt angemeldet, wie aus dem österreichischen Außenministerium zu erfahren war. Der Tagungstitel „Taking Cooperation to the Digital Age“ weist zudem darauf hin, dass Investitionen und die Digitalisierung im Mittelpunkt stehen und nicht Migration, wie in der Diaspora viele erwartet hätten. Irène Hochauer-Kpoda vom Wiener Institut für internationalen Dialog und Kooperation (vidc) hält eine Digitalisierungsoffensive für Afrika für verfrüht. Die afrikanischen Staaten seien noch nicht in der Lage seien, selbst die Kontrolle über die Technologie zu übernehmen: „Das sollte Schritt für Schritt gehen“.
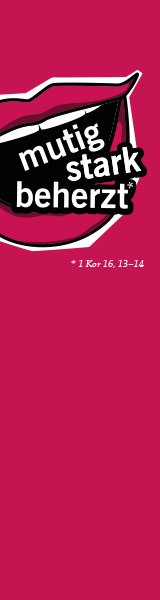
Neuen Kommentar hinzufügen