Sie haben anscheinend nichts miteinander zu tun – und dennoch werden diese beiden Ereignisse möglicherweise einmal als symbolische Wendepunkte für Eritrea gelten, den autoritären Einparteienstaat am Horn von Afrika. Das eine ist ein blutiger Zusammenstoß an Eritreas Grenze zu Äthiopien im Juni 2016, der Hunderte Menschenleben forderte und Erinnerungen an den verheerenden Krieg zwischen den beiden Erzfeinden von 1998 bis 2000 wachrief. Das andere ist eine Akademikerkonferenz in der eritreischen Hauptstadt Asmara im Juli 2016, die erste Veranstaltung dieser Art seit 15 Jahren. Die Teilnehmer staunten über den relativ freien Gedankenaustausch zu Themen von Außenpolitik bis Frauenrechten. „Es war eine mindestens so politische wie akademische Veranstaltung“, sagt Harry Verhoeven, Assistenzprofessor an der Diplomatenschule der Georgetown University in Katar.
Das sind zwei Erzählstränge ein und derselben Geschichte: Eritreas Rückkehr aus mehr als einem Jahrzehnt internationaler Isolation und die unsicheren Versuche Äthiopiens, damit klarzukommen. Die Konferenz war ein Zeichen für die vorsichtigen Bestrebungen Eritreas, wieder Anschluss zu finden; der Grenzkrieg offenbarte Äthiopiens Angst, ein rehabilitiertes Eritrea könnte seine regionale Vormachtstellung gefährden. Beides zusammen belegt, dass der seit 17 Jahren bestehende Status quo – „weder Krieg noch Frieden“ – in Bewegung geraten ist.
Im April 2017 gab Äthiopien offiziell bekannt, eine neue Politik gegenüber seinem Nachbarn am Roten Meer auszuarbeiten. Ihre Details zeichnen sich noch nicht deutlich ab, aber eines ist bereits klar: Die äthiopische Regierung gesteht ein, dass ihre Strategie der Eindämmung gescheitert ist, die sie nach dem Ende des Grenzkrieges 2000 gegenüber Eritrea eingeschlagen hatte, und die durch ein Waffenembargo der Vereinten Nationen (UN) 2009 verschärft worden war. Zum ersten Mal seit Jahren denkt man in Addis Abeba ernsthaft über einen Kurswechsel nach.
Die Durchsetzung der UN-Sanktionen gegen Eritrea steht und fällt mit der Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft, und die bröckelt allmählich. Die Sanktionen waren stets umstritten, weil sie in Eritrea den Hauptbösewicht in einer Region voller Bösewichte ausmachten. Nun wächst bei den UN langsam der Konsens, dass der wichtigste Grund nicht länger gültig ist: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Eritrea weiter die Al-Shabaab-Milizen in Somalia unterstützt. Zwar fördert Asmara nach wie vor bewaffnete Oppositionsgruppen in der Region, vor allem in Äthiopien, doch das tun seine Nachbarn auch.
Äthiopien schafft es womöglich, eine Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen bis Ende 2018 zu verhindern, wenn seine Zeit als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats abläuft. Wachsende Spannungen zwischen Eritrea und Dschibuti, nachdem Katar seine Friedenstruppe von der umstrittenen Grenze zwischen den beiden Ländern abgezogen hatte, könnten Addis Abeba kurzfristig den Rücken stärken. Aber langfristig wird es schwierig, die anderen Mitglieder zu überzeugen, den Status quo ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Denn die könnten nach dem Abgang von Präsident Barack Obama – und insbesondere seiner Sicherheitsberaterin Susan Rice, die dem eritreischen Regime gegenüber ausgesprochen feindselig eingestellt war – weniger geneigt sein, Asmara länger auf der Strafbank sitzen zu lassen.
„So lange sie da war, gab es keinen Zentimeter Spielraum“, meint Bronwyn Bruton, die stellvertretende Leiterin des Africa Center am Atlantic Council in Washington mit Blick auf Rice. Doch mit Donald Trump im Oval Office „haben alle afrikanischen Diktatoren Aufwind“, fügt sie hinzu.
Auch sonst stehen die Zeichen für Eritrea günstig. Der Krieg im Jemen, nur rund 100 Kilometer entfernt am anderen Ufer des Roten Meers, hat einen Run auf eritreische Küstengrundstücke ausgelöst. Dort wollen verschiedene Golfstaaten Militärbasen für ihre Truppen errichten. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben seit 2015 den Hafen von Assab geleast, wo sie dem Vernehmen nach einen Militärstützpunkt bauen. Unterdessen sollen rund 400 eritreische Soldaten als Teil der von den Saudis geführten Koalition im Jemen kämpfen, wofür Asmara Treibstoff und Geld erhält. „Die Golfstaaten haben Eritrea im geopolitischen Kontext des Horns von Afrika auf bemerkenswerte Weise neu positioniert“, sagt Kjetil Tronvoll, Seniorpartner des International Law and Policy Institute in Norwegen.
Zweifelhaftes „Migrationsmanagement“
In der europäischen Entwicklungspolitik ist Eritrea wieder salonfähig. Im April 2016 haben die Europäische Union (EU) und die Bundesregierung das Programm „Better Migration Management“ am Horn von Afrika ...
Auch einzelne europäische Länder und humanitäre Organisationen verstärken ihr Engagement. Deutschland hat technische Hilfsprogramme wiederbelebt, während das britische Ministerium für internationale Entwicklung in Asmara ein Büro eröffnen möchte. Vertreter des amerikanischen Außenministeriums, die das Land lange gemieden haben, lassen sich ebenfalls wieder blicken. „Die Mauer, mit der sich Eritrea so sorgsam umgeben hat, ist eindeutig gefallen“, resümiert Martin Plaut, Autor des Buches „Understanding Eritrea“. „Nun stehen alle Schlange, um ihre Aufwartung zu machen.“
Für Äthiopien ist vor allem Eritreas Annäherung an den historischen Rivalen Ägypten bedenklich. Addis Abeba wirft Kairo vor, gemeinsam mit Eritrea bewaffnete Gruppen zu unterstützen, die versucht haben, den Bau der Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre zu sabotieren. Ägypten fühlt sich von dem größten Wasserkraftprojekt des Kontinents existenziell bedroht, weil es vom Wasser des Nils abhängig ist.
In den vergangenen Monaten haben sich die Kontakte zwischen Politikern aus Asmara und Kairo intensiviert. Im November 2016 besuchte Afewerki in Ägypten Präsident Abdel Fattah als-Sisi, Eritreas Außenminister traf sich im Mai 2017 mit seinem ägyptischen Amtskollegen. Zahlreiche ägyptische Delegationen sind inzwischen in Asmara gesichtet worden, was Gerüchte über den Bau eines ägyptischen Luftwaffenstützpunkts in Eritrea verstärkt.
Kenner halten eine solche Provokation für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich: Ägypten hat Luftangriffe auf den Staudamm in Äthiopien nicht ausgeschlossen. Derweil bemüht sich Eritrea auch selbst, seinen Außenseiterstatus loszuwerden. Es wirbt um ausländische Investoren, vor allem im Bergbau. Drei neue Minen sollen 2018 den Betrieb aufnehmen; seit 2011 wird bereits in dem mehrheitlich in kanadischem Besitz befindlichen Tagebaukomplex Bisha nach Gold, Kupfer und Zink gegraben. Das hat in den ersten vier Jahren an die zwei Milliarden US-Dollar gebracht. Außerdem hat die Regierung im Hafen von Massawa eine Freihandelszone eingerichtet, um mehr Investoren anzulocken. Und sie bemüht sich mit kleinen aber symbolisch bedeutsamen Maßnahmen, ihren schlechten Ruf in Sachen Menschenrechte zu verbessern. Laut dem Atlantic Council durften zwischen Mai 2015 und Mai 2016 etwa 50 ausländische Journalisten einreisen und berichten. Vertreter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte konnten vor kurzem ein Gefängnis besichtigen.
All dies ist Anlass zur Sorge für Äthiopien, dem es missfällt, dass Eritrea seinen Einfluss an der Küste des Roten Meers ausweitet. Der Grund ist ein tiefsitzender Argwohn, der daraus resultiert, dass Äthiopien ein reiner Binnenstaat ist. Zudem hat man Angst, Afewerki könnte seine wachsenden finanziellen Mittel verstärkt zur Unterstützung der bewaffneten Opposition in Äthiopien einsetzen, und das zu einem Zeitpunkt, da das Land nach Monaten der Unruhe bereits im Ausnahmezustand ist. Am meisten fürchtet sich Äthiopien aber davor, von feindlich gesinnten Regimen eingekreist zu werden.
Im Unterschied zu Eritrea unterhält Addis Abeba nur schwache Beziehungen zu den Golfstaaten, und seine Bemühungen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien davon abzubringen, sich Asmara anzunähern, sind offensichtlich wenig erfolgreich. Äthiopien versuchte, sich mit Gesten demonstrativer Stärke zu helfen, darunter der Bombardierung der Bisha-Mine im Jahr 2015. Inoffiziell ist von Regierungsvertretern in Asmara zu hören, dass es in den vergangenen Jahren zahlreiche ähnliche Provokationen gegeben habe.
Experten sind unsicher, worauf eine neue äthiopische Politik gegenüber Eritrea hinauslaufen wird. Einige vermuten nicht mehr als Korrekturen der bisherigen Strategie, die hauptsächlich rote Linien markiert und klar androht, wie die militärische Antwort auf ihre Überschreitung ausfallen wird. Andere fragen sich, ob die Regierung in Addis Abeba insgeheim die Aufnahme bilateraler Gespräche plant, und vielleicht sogar den Rückzug aus der Grenzstadt Badme anbietet, die äthiopische Truppen seit 15 Jahren widerrechtlich besetzt halten. Möglich wäre aber auch ein Krieg, um in Asmara einen Regimewechsel zu erzwingen. Angesichts der Schwäche des äthiopischen Militärs und der Furcht vor einem völligen staatlichen Zusammenbruch des nördlichen Nachbarn ist das allerdings unwahrscheinlich.
Die politischen Verhältnisse in Äthiopien erschweren eine mutige Neuausrichtung. Die regierende Parteienkoalition, die Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker, ist tief zerstritten, und Premierminister Hailemariam Desalegn mangelt es an der Autorität, entschlossen die Beziehungen zu Eritrea neu zu ordnen. Die Falken im Militär und in den Geheimdiensten müssen eingebunden werden, und das heißt, alles zu vermeiden, was nach einer demütigenden Aufgabe der bisherigen aggressiven Linie aussehen könnte.
Eritrea wird manchmal auch „das Nordkorea Afrikas“ genannt, nicht zu Unrecht vielleicht, obwohl dem Land ein mächtiger Schutzpatron wie China fehlt, der den Einfluss hätte, es an den Verhandlungstisch zu zwingen. Afewerki profitiert weiter von der Aufrechterhaltung des permanenten Kriegszustands. Jüngste Berichte, laut denen eritreische Soldaten nach dem Abzug katarischer Friedenstruppen von der Grenze zu Dschibuti im Handstreich die dortigen umstrittenen Gebiete besetzt haben, sind eine Mahnung, dass Eritrea nach wie vor die Rolle des Quertreibers in der Region spielen kann.
Und auch wenn Asmara nun weniger isoliert dasteht, bleibt es viel schwächer als Addis Abeba. Am Ende wird sich die äthiopische Seite einen Ruck geben müssen. „Die Situation birgt viele Risiken, verspricht aber auch große Belohnungen“, sagt Verhoeven von der Georgetown University. „Ich bin vorsichtig optimistisch.“
Tom Gardner ist Äthiopien-Korrespondent des „Economist“. Sein Beitrag ist im Original bei „Foreign Policy“ erschienen.
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
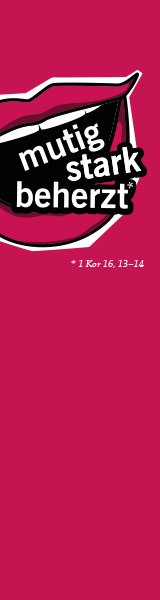
Neuen Kommentar hinzufügen