Misael Contreras blickt ständig um sich: nach links, nach rechts, über die Schulter. Er sitzt am Tisch eines kleinen Cafés in einer lauten Shopping Mall, Menschen mit vollen Plastiktüten gehen vorüber. Contreras ist in ständiger Alarmbereitschaft. Auch wenn er im Stadtbus unterwegs ist. „Du weißt nie, wann und von woher etwas kommt“, sagt er. Seit vier Monaten lebt er wieder in El Salvador, seitdem steht er unter Hochspannung. Vorher war er acht Jahre lang in den USA – illegal. Und doch war er dort viel ruhiger.
Mit knapp 18 Jahren schickte ihn seine Familie in den Norden. Die Risiken auf dem Weg – Überfälle, Entführungen, Tod – spielten keine Rolle angesichts der Gefahr, die ihm zu Hause drohte: dem Zwang, sich einer Mara anzuschließen, einer jener gefährlichen Jugendbanden, die in Zentralamerika ganze Stadtteile kontrollieren und jeden jungen Mann mit dem Tod bedrohen, der nicht mitmachen will. Im Vergleich dazu kam ihm der lange Weg in den Norden fast schon wie eine Abenteuerreise vor. 6500 US-Dollar hat seine Familie dem „Coyoten“ bezahlt, dem Schlepper, der ihn über die Grenze brachte. Einen Monat war Misael unterwegs.
Heute kassieren die „Coyoten“ 12.000 Dollar für solche Dienste, ihre Arbeit tun sie seit Jahrzehnten. Die Massenauswanderung von Salvadorianern in die USA begann in den 1980er Jahren, eine Folge des bis 1992 dauernden zwölfjährigen Bürgerkriegs. Mehr als zwei Millionen Salvadorianer – rund ein Drittel der Bevölkerung – leben heute nach Schätzungen der Regierung in den Vereinigten Staaten. Der Krieg ist längst vorbei, doch die Gewalt hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Heute sterben in El Salvador so viele Menschen eines gewaltsamen Tods wie zu Zeiten des Bürgerkriegs: Damals wurden im Durchschnitt 6600 Menschen pro Jahr getötet, so viele wie im vergangenen Jahr. Das treibt viele Salvadorianer in die Flucht. In Guatemala hat sich die Zahl der Asylanträge zwischen 2013 und 2014 nahezu verdoppelt, in Mexiko verdreifacht und in den USA sogar vervierfacht.
Die größte Jugendbande wurde in Los Angeles gegründet
Ilopango, ein Vorort der Hauptstadt San Salvador, gilt als besonders gefährlich. Dort wohnt Misael bei seinen Großeltern. Verantwortlich für die Gewalt sind vor allem die Jugendbanden. Die größte, die mehrere zehntausend Mitglieder zählende „Mara Salvatrucha“, haben Kinder von Flüchtlingen in den 1980er Jahren in Los Angeles gegründet. Nach dem Ende des Krieges wurden die kriminellen Jugendlichen nach El Salvador abgeschoben und errichteten dort ihre Herrschaft aus Angst und Erpressung. Mit anderen Banden liefern sie sich blutige Gefechte um Einflussgebiete, sie handeln mit Drogen und erpressen Schutzgeld.
Aus diesem Hexenkessel ist Misael geflohen. Er wollte eigentlich bleiben und den Hauptschulabschluss nachholen. Aber an den Schulen versuchten die Maras, neue Mitglieder anzuwerben, erst freundlich und dann mit Gewalt. Er wurde überfallen, es kam zu einer Schlägerei. „Aber ich hatte Glück“, erzählt er. „Ein Straßenköter in der Nähe hat sich so aufgeregt, dass er einen der Angreifer gebissen hat. Da haben sie aufgehört.“ Fortan aber war es für ihn noch gefährlicher in Ilopango. Der Stadtpark, die Bushaltestellen, alle öffentlichen Orte wurden schon damals und werden noch immer von Maras kontrolliert. Er sah keine andere Möglichkeit mehr, als seiner Mutter zu folgen. Die war schon drei Jahre zuvor illegal in die USA ausgewandert.
An einem frühen Morgen des Jahres 2008 stieg Misael an einer Tankstelle im US-Bundesstaat Maryland aus dem Bus. Seine Mutter wartete dort auf ihn. „Ich war im Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, erzählt er. „Ich war entspannt. Ich wusste, dass ich hier irgendetwas arbeiten konnte und niemand mich daran hindern würde.“ In seinem ersten Job arbeitete er als Gärtner. Er verdiente 9,50 US-Dollar in der Stunde. Später schuftete er auf dem Bau und bekam zwischen 600 und 700 Dollar in der Woche. Viel Geld, denn in El Salvador verdienen Arbeiter den Mindestlohn von gerade mal 242 Dollar im Monat. Doch dann kam die Banken- und Immobilienkrise und er wurde entlassen. Später lieferte er für einen Großhändler Lebensmittel aus, stürzte dabei aber schwer und verlor am Tag darauf seine Arbeit. Immerhin hat ihm ein Anwalt eine Abfindung erstritten.
Von Beamten der Einwanderungsbehörde geweckt
Contreras tat sich dann mit einem salvadorianischen Freund zusammen, der als selbstständiger Mechaniker Autos reparierte. „Ich hatte keine Ahnung“, sagt er und lacht. „Ich konnte nicht einmal einen Reifen wechseln.“ Er lernte durch Zuschauen und Nachmachen und bald florierte das Geschäft. Misael kaufte sich ein Motorrad, obwohl er keinen Führerschein hat. Weil er immer wieder von der Polizei angehalten wurde, sammelte er ein paar Strafzettel. Zuletzt erwischte man ihn, als er den Wagen eines Kunden Probe fuhr. Er kam als Wiederholungstäter vor Gericht und wurde zu zehn Tagen Arrest verurteilt. Damit hatten die Behörden seine Adresse. Und am frühen Morgen des 13. März 2015 wurde er von Beamten der Einwanderungsbehörde geweckt.
Die Gefahr war ihm eigentlich bekannt. „Seit 2015 kann jeder Illegale, der mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, verhaftet werden – selbst dann, wenn es sich um eine Bagatelle handelt“, weiß Misael. Sieben Monate war er im Gefängnis, weil er kein Geld für die Kaution hatte. Sein Anwalt kämpfte vergeblich gegen eine drohende Abschiebung. Das Gericht argumentierte, er habe schließlich in den USA keine Familie zu ernähren.
Contreras beantragte Asyl mit dem Argument, er wohne in El Salvador in einer von Banden kontrollierten Gegend, als junger Mann sei dort sein Leben in Gefahr. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen sieht das genauso: In den Ländern El Salvador, Guatemala und Honduras herrsche auf Grund der weit verbreiteten Gewalt eine Flüchtlingskrise. Doch der Asylantrag wurde abgelehnt. Contreras wurde abgeschoben - als einer von gut drei Millionen Menschen aus Zentralamerika, die in der bisherigen Regierungszeit von Präsident Barack Obama deportiert wurden. Lateinamerikaner in den USA nennen Obama deshalb den „Deportador en Jefe“, den „Chefabschieber“.
Autorin
Contreras traut sich kaum auf die Straße. Chancen auf einen Job hat er nicht. „Wenn der Arbeitgeber meine Adresse sieht, heißt es gleich: Ach so, du bist von dort, wo die Mara Salvatrucha herrscht“, erzählt er. Zehn Jahre lang darf er nicht mehr in die USA einreisen. Das kümmert ihn nicht. Er will wieder weg, sobald er das Geld für einen „Coyoten“ aufgetrieben hat. Es hat ja schon einmal geklappt.
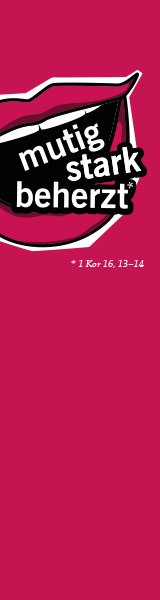
Neuen Kommentar hinzufügen