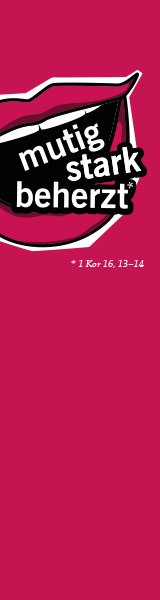Alle sind sie da: von Emporio Armani über Gucci bis Karl Lagerfeld. Das Öl unter der Stadt und draußen unter dem Kaspischen Meer hat Aserbaidschans Hauptstadt Baku neuen Reichtum beschert. Wie Pilze schießen die Hochhäuser aus dem Boden. Zwar sind viele nur Gerippe, in ihrem Imponiergehabe gebremst von der Finanzkrise. Aber in den teuren Bars der Uferpromenade herrscht eine aufgeräumte Stimmung.
Autor
Johannes Schradi
war bis Frühjahr 2013 Berlin-Korrespondent von „welt-sichten“.Nur wenige Kilometer weiter wird die neue Glitzerwelt zum Alptraum: Erdöl sickert ins Steppengras, füllt schwarze Tümpel. Die stählernen Fördergerippe sind Hinterlassenschaften der Sowjetzeit. Aus der klebrigen Brühe ließen sich hübsche Fackeln für Gartenpartys fabrizieren, sagt bitter ein Mitglied des Oil Worker’s Committee. Mirvary Gahramanly, die Vorsitzende dieser aserbaidschanischen nichtstaatlichen Organisation (NGO) und eine frühere Öl-Ingenieurin, hat Fotos mitgebracht. Sie zeigen: Dort, wo heute Öl gefördert wird, sieht es oft nicht viel besser aus – besonders nicht für die, die dort arbeiten. Dreck, gefähliche Arbeitsbedingungen und schlechte Unterkünfte sind an der Tagesordnung.
Einer der Hauptgründe für solche Missstände sei die grassierende Korruption im Land, sagen übereinstimmend Mirvary Gahramanly und die junge, resolute Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation WARD, Shahla Ismayilova. Beide setzen sich mit Aufklärungs-, Beratungs- und Lobbyarbeit für mehr soziale Rechte und einen besseren Schutz der Menschenrechte ein. Kein Behördengang, kein Arzt-, kein Schulbesuch, kein Berufseinstieg sei ohne Schmiergeld möglich, klagen sie. Ein Hinweis darauf, dass sich das so bald nicht ändern wird, ist für die NGO-Vertreterinnen die kaum bemäntelte Ablehnung und Repression, die ihnen von Regierungsseite entgegenschlägt.
Zwar herrscht seit Ende der Sowjetzeit formal Demokratie in der östlichsten und einzig islamischen der drei südkaukasischen Republiken Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Aber Präsident Ilham Alijews Führungsstil ist autokratisch – eine Scheindemokratie. Wer im Land organisiert zivilgesellschaftlich arbeiten will, muss erst einmal registriert werden. Das ist für die „GONGOS“, die „vom Staat organisierten NGOs“, kein Problem. Für alle anderen ist es ein enges Nadelöhr. Die Organisationen der beiden Frauen sind zugelassen. Rund 30.000 Frauen nehmen die Fortbildungs- und Beratungsangebote von WARD wahr. Aber „ich weiß nicht, wie die Regierung reagiert, wenn wir weiter wachsen sollten“, sagt Shahla Ismayilova. Sie setzt auf den Schutz und die Unterstützung ausländischer NGOs, der britischen und der US-amerikanischen Botschaft und des UN-Flüchtlingskommissars UNHCR.
Schwieriger Neubeginn
Auch in Georgien und Armenien wären unabhängige NGOs ohne Hilfe von außen kaum überlebensfähig. Zu ihren Förderern zählt auch der deutsche Evangelische Entwicklungsdienst (EED). „Wir verfolgen im Südkaukasus vor allem zwei Ziele: die Menschenrechte zu stärken und die ländliche Entwicklung zu fördern“, sagt dessen Regionalreferentin Felicitas Menz, die Kontakt zu rund drei Dutzend lokalen Partnerorganisationen hält. Sie weiß aus Erfahrung: Es geht darum, die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen ernst zu nehmen und an sie anzuknüpfen.
Aber das ist leichter gesagt als getan – gerade im Kaukasus. Mit dem politische Ende der Sowjetunion 1991 brach die jahrzehntelange Kollektivwirtschaft schlagartig zusammen. Plötzlich waren Eigeninitiative und Eigenverantwortung gefragt. Aber den Menschen fehlten alle Voraussetzungen dafür. Zugleich sind viele von ihnen beseelt von einem tief sitzenden Ressentiment: Nie wieder Sozialismus, nie wieder Kollektivarbeit! Das macht den Neuanfang doppelt schwer.
In den Weiten der aserbaidschanischen Steppe sind die Böden versalzen und ausgetrocknet. Wie die meisten Fabriken aus der Sowjetzeit funktionieren die aufwändigen Bewässerungssysteme der großindustriell betriebenen Landwirtschaft nicht mehr. Die Bauern wissen nicht recht, was sie mit dem ihnen zugewiesenen Land tun sollen: 0,4 Hektar pro Person. Wer von Zusammenschluss nichts wissen will, steht auf fast verlorenem Posten. Nur mit gebündelter Kraft ließen sich die Bewässerung wieder in Gang bringen und die verrotteten Maschinen ersetzen. Mühsam versucht die NGO Agro Information Centre (AIM), den neuen Kleinbauern beizubringen, wie sie ihre Felder biologisch bewirtschaften können, und sie wenigstens zu einem Minimum gemeinsamen Wirtschaftens anzuhalten.
Szenenwechsel ins Nachbarland: George Tugushi strotzt vor Selbstbewusstsein. Der 33-Jährige ist der parlamentarisch gewählte Ombudsman Georgiens und residiert im ehemaligen Domizil des Sowjetgeheimdienstes KGB in Tiflis. „Public Defender“ prangt groß über dem Eingang. „Ich erwarte Ergebnisse, nicht Versprechen“, sagt Tugushi in fließendem Englisch. „Wenn ein Minister mir nicht zuhört und Informationen zurückhält, dann gehe ich an die Öffentlichkeit.“ Wer mit der Polizei in Konflikt gerät oder im Gefängnis misshandelt wird, kann bei ihm um Rechtshilfe nachsuchen.
Ein 200-seitiger Report listet akribisch den aktuellen Stand in Sachen Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten in Georgien auf. Er beschreibt auch die elende Lage der rund 250.000 Binnenflüchtlinge, die es infolge der bewaffneten Konflikte um Abchasien zu Beginn der 1990er Jahre und dem georgisch-russischen Krieg um Südossetien 2008 im Kernland gibt. Sie sind Georgiens derzeit brisantestes Problem. Vieles von dem, was in dem Report steht, bliebe bloßes Papier ohne die vielen NGOs im Land, die in die Flüchtlingsarbeit eingebunden sind, sagen NGO-Vertreter. Beim gesamten sozialen Auf- und Umbau des Landes spielen sie eine tragende Rolle. Gern überlässt ihnen der bei weitem am westlichsten orientierte Staat der Region Aufgaben, die eigentlich seine sind.
Voller Stolz präsentiert eine Vertreterin des Zentrums für strategische Forschung und Entwicklung in Georgien (CSRDG) Erfolgsgeschichten der neuen „Selbstregierung“ (selfgovernment). Da werden lokale Führungskräfte geschult und kommunales Finanzmonitoring eingeübt. Aber da werden auch Dorfbewohner zum Flicken von Straßen animiert, Kanäle ausgehoben und kommunale Kindergärten frisch verputzt. Eine andere NGO, Elkana, bemüht sich darum, den Weinbauern Georgiens neue Märkte zu erschließen; seit dem Krieg von 2008 ist ihnen der Zugang zu ihrem früheren Hauptabnehmer, Russland, verwehrt.
„Wir sind Biotope“, fasst Nino Lejava, eine Mitarbeiterin des Centrums für internationale Migration und Entwicklung (CIM) bei der georgischen Consultant-Stiftung CTC, die Lage der NGOs in Georgien zusammen. Diese Biotope könnten allerdings rasch austrocknen, sollte politisch der Wind drehen; niemand traut recht der demokratischen Standfestigkeit von Präsident Micheil Saakaschwili und seiner Regierung. Nicht weniger bedrohlich wäre, sollte die internationale Unterstützung für Georgien nachlassen, wofür es viele Anzeichen gibt. Einen „Liebling der Geber“ nennt die für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Botschaftsrätin in der deutschen Vertretung in Tiflis, Silke Klöver, Georgien und meint damit das viele westliche Entwicklungs- und Hilfsgeld, das bis heute auch die NGO-Szene nährt.
Klage über „Sowjet-Mentalität“
Im westarmenischen Gyumri braucht Bischof Michael von der Armenisch-Apostolischen Kirche eine Weile, bis er sich warm geredet hat. Dann bricht es aus ihm heraus: „Seine Majestät sitzt nur im Büro“, sagt er über den Ortsvorsteher und bescheinigt ihm „Sowjet-Mentalität“. Nichts gehe in der Sozialpolitik voran, außer dass einmal ein paar Toiletten gebaut würden. Eine gedeihliche Zusammenarbeit komme nicht zustande, und auch die Menschen in und um Gyumri müssten nach Jahrzehnten atheistischer Staatsführung „erst wieder lernen, dass die Kirche ihnen ein Angebot macht“.
Die Stadt liegt im Epizentrum des schweren Erdbebens von 1988. Noch heute leben viele der Opfer in Behelfscontainern; Häuser und Wohnungen sind oft nur notdürftig repariert. Das Ende der Sowjetherrschaft knapp drei Jahre später und der fast komplette Zusammenbruch der einst florierenden armenischen Industrie brachte doppelte Not. Viele junge Männer versuchen als Wanderarbeiter ihr Glück in Russland; schwere Familienkonflikte daheim sind nicht selten die Folge. Viele verlassen das Land für immer.
Die armenische Kirche lebt allein von Spenden. Doch sehen viele Spender der großen weltweiten armenischen Diaspora ihr Geld lieber in Kirchenbauten investiert als in dörfliche Sozialzentren. Das ist in Armenien nicht anders als in Georgien. So tut Bischof Michael, was er kann. Das wieder hergerichtete Gemeindezentrum mit seinen Bildungs- und Freizeitangeboten ist für alle offen.
Handfeste Sozialarbeit leistet eine NGO wie die Women for Development (WFD). In enger Kooperation mit staatlichen Gemeinde-Krankenschwestern organisiert sie in zahlreichen Dörfern der Region Gesundheitsberatung. Das Sacharow-Zentrum wiederum zielt darauf, zivilgesellschaftliches Engagement und rechtstaatlich-demokratische Strukturen zu fördern, mit Gewicht vor allem auf der Stärkung der Menschenrechte – Konflikte mit staatlichen Stellen sind vorprogrammiert. Rechtstaatlichkeit ist schwach entwickelt in Armenien, es herrscht eine von wenigen Personen und Oligarchen dominierte Elite. Der „Transformationsprozess ist stecken geblieben“, sagt ein politischer Insider. Noch ist in Armenien die Sowjetzeit präsenter als in den Nachbarländern Georgien und Aserbaidschan. Viele Laden- und Werbeaufschriften sind in armenischer und russischer Sprache.
„Mit dieser Kommune arbeiten wir nicht zusammen“, sagt entschieden Haik Minassian und zeigt, nahe der streng bewachten Grenze zur Türkei, auf ein brach liegendes Feld. Über den Dorfvorsteher weiß man, dass er Stimmen gekauft hat, um ins Amt zu kommen – eine Praxis, die auch auf höherer Ebene gang und gebe ist. Minassian war einst Physikprofessor und ist heute Direktor der vornehmlich auf dem Land arbeitenden Groß-NGO Shen, was so viel wie „florierend und reich“ heißt. Bischof Michaels düsteres Bild von der Lage im Land kann er nicht teilen. Die Bürgermeister seien meist kooperativ, sagt er.
Erfolgsprojekt Bio-Anbau
Das Land, auf dem gewirtschaftet wird, ist häufig kommunales Pachtland. Wo noch vor wenigen Jahren steinige Steppe war, wachsen heute Tausende Obstbäume, biologisch angebaut. Das zahlt sich aus. Die süßen, festen Aprikosen finden viele Käufer, daheim und auch auf dem wichtigen russischen Markt. Die neue Bewässerung wird dank der Beratung von Shen gemeinsam organisiert und betrieben. Von den Berührungsängsten der Bauern mit gemeinschaftlichen Bewirtschaftungsformen wie im Flachland des benachbarten Aserbaidschan ist nichts zu spüren.
In den Ländern im südlichen Kaukasus haben der türkische Genozid von 1915/16 an den Westarmeniern und die neueren ethnische Konflikte in Südossetien, Abchasien und Berg Karabach nationale Verwundungen und hunderttausende Binnenflüchtlinge hinterlassen. Das sowie undurchsichtige Machenschaften kleiner Eliten, die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, empfindliche Aderlässe durch Abwanderung und wirtschaftliche wie mentale Altlasten aus der Sowjetzeit schaffen einen fragilen Schwebezustand, eine Zerrissenheit, die sich ohne weitere Hilfe von außen kaum wird überwinden lassen. „Mir gefällt die deutsche Richtigkeit“, sagt in Erewan ungefragt auf Deutsch ein junger Mann auf einem staubigen Lagerhof und meint damit vieles zugleich: Genauigkeit, Pünktlichkeit, Sicherheit und dass alles mit rechten Dingen zugehen möge. Arzt will er einmal werden. Schon heute steht für ihn fest, dass er sein Land verlassen wird, wie so viele vor ihm. Er wird gehen, auch wenn er weiß, dass er daheim fehlen wird.