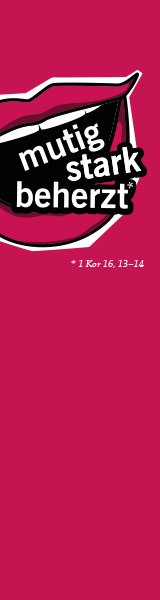Von Bayarmaa Tudevrenchin
Der vergangene Winter war für die nomadischen Viehzüchter in der Mongolei eine Katastrophe, von der sie sich bis heute nicht erholt haben. Rund 9000 Haushalte haben keinerlei Vieh mehr, 35.000 haben bis zur Hälfte ihrer Herden verloren. Vier Fünftel der Landesfläche und fast 100.000 Viehzüchter-Familien sind betroffen; damit sind die Folgen sogar schlimmer als die der dreijährigen Winterdürre von 1999 bis 2001. Insgesamt ein Fünftel des Viehbestandes ist dahin, das bedeutet Verluste im Marktwert von schätzungsweise 200 Millionen Euro. Das schädigt das gesamte Land – die Viehzucht macht etwa 30 Prozent der Volkswirtschaft aus; etwa 380.000 Haushalte mit über eine Million Menschen leben davon, mehr als jeder dritte Einwohner.
Die Winterdürre ist seit je eine der schlimmsten Naturerscheinungen für die nomadischen Viehzüchter in der Mongolei. Dabei fällt eine enorme Menge Schnee, so dass die Tiere nicht mehr an die Pflanzen darunter gelangen, es herrscht sehr strenge Kälte oder beides. Der Volksmund nennt das „Dzud“. Im vergangenen Winter fiel die Temperatur bis auf minus 40 Grad Celsius, und die Schneedecke war bis zu einem Meter dick. Die meisten betroffenen Gebiete hatten im Sommer 2009 unter großer Hitze gelitten, die die Weideplätze verdorren ließ, so dass die Herden kaum an Futter und Nahrung gelangen und die Viehzüchter ihre Heuvorräte nicht auffüllen konnten.
Frühe und schwere Schneefälle machten es dann fast unmöglich, mit den Herden in andere Gebiete zu ziehen. Infolge der undurchdringlichen Schneedecke und der kalten Temperaturen verendeten zahlreiche Tiere. Offiziell waren im Jahr 2009 in der Mongolei rund 40 Millionen Stück Vieh registriert – davon sind laut offiziellen Angaben etwa 9 Millionen an den Folgen der Winterdürre gestorben. Winterdürren lassen aber nicht nur die betroffenen Haushalte verarmen, sondern senken letzten Endes das gesamte Lebensniveau im Land, weil zum Beispiel die Fleischpreise für die Verbraucher in den Städten stark steigen. Hinzu kommt, dass die von der Winterdürre betroffenen Viehzüchter weder die nächsten Nachbarn noch medizinische Betreuung erreichen können.
Winterdürren gibt es in der Mongolei seit Jahrtausenden. Sie treten etwa alle zehn Jahre auf. Allein im 20. Jahrhundert erlebten die Mongolen mehr als zehn Winterdürren. Die schlimmsten Folgen hatte die von 1944/1945, bei der 8,6 Millionen Stück Vieh starben. Die schlimmste der neuesten Zeit war bis zum vergangenen Winter die in den Jahren 1999 bis 2001. Damals haben die Viehzüchter insgesamt 11 Millionen Stück Vieh verloren. Diese Dürre war die erste, die auch in der westlichen Welt Beachtung fand.
Auch der Rückgang des Viehbestandes infolge solcher Naturkatastrophen war und ist eine übliche Erscheinung. Wenn die Nomaden früher eine Winterdürre kommen sahen, zogen sie weg und verbrachten den Winter in freundlicheren Gegenden. Das hat sich als einzige und wirksame Methode erwiesen, den Schäden vorzubeugen – auch wenn es nicht immer Möglichkeiten für eine Überwinterung mit geringen Verlusten gab. Heute ist das schwieriger geworden. Das Vordringen der staatlichen Verwaltung und die Zuordnung der Viehzüchter zu bestimmten Verwaltungsregionen erschwert das Ausweichen mit den Viehherden in andere Regionen. Die Verstädterung verringert die Weideplätze; auch das beschränkt die Möglichkeiten, mit dem Vieh umherzuziehen.
Zudem hat es das Ende des Sozialismus für die Nomaden schwieriger gemacht, Naturkatastrophen zu bewältigen. Ausgerechnet in den sozialistischen Jahren bis 1990 waren die Folgen von Winterdürren weniger gravierend als heute. Dies ist vor allem damit zu erklären, dass der gesamte Viehbestand Staatseigentum war und es als Verpflichtung für jeden – nicht nur der Viehzüchter – aufgefasst wurde, mit vereinten Kräften die schlimmen Folgen der Dürren zu bekämpfen. Selbst Schüler mussten den Viehzüchtern helfen. Gut organisierte staatliche Hilfe trug zur Überwindung der Schäden von Winterdürren bei. Anfang der 1990er Jahre wurde dann mit dem Übergang zur freien Marktwirtschaft der Viehbestand privatisiert. Damit begann für die Viehzüchter eine neue Zeit. Auf der einen Seite waren sie zufrieden, nun das Vieh zu besitzen, aber auf der anderen Seite mussten sie ab sofort die volle Verantwortung für ihre Herden und die damit verbundenen Risiken tragen.
Doch nicht nur die Bewältigung von Naturkatastrophen ist schwieriger geworden. Die Bedingungen für die traditionelle nomadische Viehzucht haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt stark verschlechtert. Zum einen hat der Ausbau der Bergbauindustrie, vor allem von Gold- und Kohleminen, das Gleichgewicht der Natur auf weiten Flächen des Landes zerstört, so dass Hunderte Wasserstellen und Wasserläufe verschwunden und nicht mehr regenerierbar sind. Zum anderen ist der Viehbestand unkontrolliert gewachsen, ohne einer Entwicklungsstrategie zu folgen. Um zu überleben, sind Nomadenhaushalte gezwungen, vor allem mehr Ziegen zu halten, da die Preise für Ziegenwolle relativ hoch sind. Traditionell haben die Mongolen den Anteil der Ziegen an ihrem Viehbestand auf höchstens ein Zehntel begrenzt, weil Ziegen die Futterpflanzen mit den Wurzeln verzehren. Heute aber gibt es etwa 20 Millionen Ziegen im gesamten Viehbestand von etwa 40 Millionen.
Das alles trägt zur Verwüstung weiter Gebiete bei; bis zu 90 Prozent der Mongolei sind bereits davon betroffen. Das Vordringen der Wüsten verstärkt zudem die Winterdürren: Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für den „Dzud“ steigt, je weiter die Verwüstung fortschreitet. Hinzu kommt, dass sich in weiten Teilen der Steppenregionen Zentralasiens die Erderwärmung und ihre schädlichen Folgen zunehmend bemerkbar machen.
Eine Folge ist die massenhafte Umsiedlung vom Land in die Stadt. Offiziell hat die Hauptstadt Ulan Bator rund eine Million Einwohner. Aber weil immer mehr Menschen in die Stadt ziehen oder auch „schwarz“ dort wohnen, muss man eher von 1,7 Millionen ausgehen. Dabei hat die Mongolei insgesamt nur 2,8 Millionen Einwohner. Der Zuzug in die Hauptstadt erhöht die Zahl der Arbeitslosen und der armen Haushalte dort. Auch die Kriminalität und die Luftverschmutzung steigen, weil im Jurtenviertel die Haushalte mit allem heizen, was brennbar ist, sogar mit alten Autoreifen. Diesen akuten Problemen ist die Regierung nicht gewachsen.
Während der jüngsten Winterdürre hat die mongolische Regierung versucht, der betroffenen Bevölkerung so gut wie möglich Nothilfe zu leisten. Sie lieferte Heu aus staatlichen Vorräten, stellte medizinische Betreuung bereit und ließ Hilfsgüter verteilen. Insgesamt leisteten die Regierung, andere Staaten sowie internationale Hilfsorganisationen und einheimische Bürger Hilfe in Höhe von insgesamt 14 Millionen Euro; gut die Hälfte davon stammte aus ausländischen Quellen. Die Hilfe kam aber nicht bei allen Bedürftigen an, weil die schlechte Infrastruktur die Lieferungen erschwerte. Das hat der Regierung Kritik von Seiten der Viehzüchter eingetragen.
Doch Nothilfe genügt nicht. Die Möglichkeiten, mit der traditionellen nomadischen Viehzucht den Lebensunterhalt zu bestreiten und auch Naturkatastrophen zu überstehen, sind sehr viel schlechter geworden. Die Regierung versucht daher, auf dem Land andere Arbeitsplätze zu schaffen und den Übergang von der traditionellen Form der Viehwirtschaft zu moderneren Formen der Landnutzung voranbringen. Mit Unterstützung internationaler Organisationen führt sie beispielsweise Projekte und Programme für ein besseres Management der Weiden durch. Leider sind die Erfolge bisher weitgehend ausgeblieben; viele Viehzüchter sind gegenüber diesen Vorhaben ohnehin kritisch eingestellt. Agrarwissenschaftler empfehlen, nicht länger auf die Größe der Herden zu setzen, sondern auf ihre Qualität, und die traditionelle Weidewirtschaft mit Ackerbau zu ergänzen. Auch hier sind die Fortschritte bisher gering.
Doch ein Vorhaben der Regierung zeigt Wirkung: Mit finanzieller Unterstützung der Weltbank versucht sie, eine neue Art der freiwilligen Versicherung von Viehbeständen durchzusetzen. Diese Versicherung soll die Risiken und Folgen der Winterdürren für die Landbevölkerung vermindern, so dass sie nicht in die Stadt ziehen müssen. Seit vier Jahren wird das Programm in 9 der 21 Provinzen verwirklicht, in zwei Jahren soll es aufs ganze Land ausgedehnt werden. Es hat sichtbar Erfolg: In den Jahren 2007 bis 2009 hat die Versicherung insgesamt Entschädigungen in Höhe von 800 Millionen Tugrik (etwa 480.000 Euro) ausgezahlt. Allein für die Schäden der jüngsten Winterdürre wird eine Summe von rund einer Milliarde Tugrik ausgeschüttet. Allerdings lässt die Bereitschaft vieler Viehzüchter, ihre Herden freiwillig zu versichern, noch zu wünschen übrig – manche behaupten, aus Geldmangel. In Kooperation mit einigen Banken werden den Viehzüchtern deshalb zinsgünstige Kredite für die Versicherung angeboten, bisher aber mit geringem Erfolg.
Die Viehzüchter selbst aber müssen sich von der alten sozialistischen Denkweise lösen, sich modernen Wirtschaftsformen öffnen und sich neue wirtschaftliche Kenntnisse aneignen. Die verschiedenen Reformschritte müssen gleichzeitig verwirklicht werden. Nur dann kann die Viehwirtschaft, die 30 Prozent der ganzen Volkswirtschaft ausmacht und die Lebensgrundlage eines bedeutenden Teils der Bevölkerung bildet, Naturkatastrophen wie Sommer- und Winterdürren mit geringen Verlusten überstehen.
Bayarmaa Tudevrenchin ist Journalistin und arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Mongolei in Ulan-Bator.