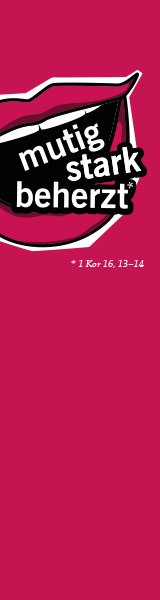Mobilität gilt bei uns als Zeichen für Dynamik und Erfolg. War das schon immer so?
Definitiv nicht. Bis ins 18. Jahrhundert galt Mobilität eher als Strafe denn als Segen. Die Verweisung aus der Stadt – also gewissermaßen die Zwangsmobilisierung – war einer der schweren Strafen, die die damalige Zeit kannte. Und denjenigen, die aufgrund ihres Berufes mobil waren, etwa Händler oder Schausteller, wurde mit Argwohn begegnet. Erst im 20. Jahrhundert, mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, wurde Mobilität mehr und mehr zum Symbol für Freiheit, Aufbruch und Fortschritt. Heute wiederum, in Zeiten, in denen eine hohe berufliche Mobilität erforderlich ist, finden wir eine ambivalente Situation vor: Zum einen wird Mobilität von Wirtschaft und Politik sehr hoch bewertet als Symbol für Erfolg und als Mittel zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Zum anderen stellen wir fest, dass immer mehr Menschen Mobilität als Zwang erleben. Sie sind nicht mehr freiwillig mobil, sondern aufgrund gesellschaftlicher Umstände. Und da verliert Mobilität zunehmend die Idee von Fortschritt, Freiheit und Aufbruch.
Ist der Mensch von Natur aus eher sesshaft oder offen für Mobilität?
Das kann man nicht allgemein beantworten. Es gibt Menschen, die sich aktiv um neue Jobs bemühen, die mit einem Ortswechsel verbunden sind und die sich auf Dienstreisen freuen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind durch und durch sesshaft, nicht nur von ihren Lebensumständen her, sondern auch von ihrer Persönlichkeit. Die sind kaum in der Lage, mobil zu werden. Mobilität ist da eher angstbesetzt.
Gibt es Unterschiede zwischen Kulturen hinsichtlich der Bereitschaft zu einem mobilen Lebenswandel, zum Beispiel zwischen Nord- und Südeuropa?
Die Unterschiede zwischen Ländern sind kleiner als die zwischen sozialen Gruppierungen. Akademiker haben zum Beispiel eine besonders hohe Bereitschaft zu Mobilität. Es gibt aber Besonderheiten in einzelnen Ländern, zum Beispiel in solchen mit Sprachgrenzen wie Belgien oder der Schweiz. Umzüge finden selten über die Sprachgrenzen hinweg statt. Wenn die Leute überhaupt über Sprachgrenzen hinweg beruflich mobil sind, dann pendeln sie. In Frankreich ist die Besonderheit, dass auch hier die Menschen nur ungern innerhalb des Landes umziehen, es sei denn es geht nach Paris. Für alle Länder Europas gilt: Die Menschen pendeln eher anstatt umzuziehen.
Wie verändert hohe Mobilität eine Gesellschaft?
Zum einen erhöht sich das Risiko stressbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Der Mobilitätsdruck senkt also potentiell die Lebensqualität in einer Gesellschaft. Und das hat auch wirtschaftliche Folgen, zum Beispiel höhere Ausfallzeiten in den Betrieben und steigende Kosten der Gesundheitsversorgung. Zum anderen haben mobile Menschen oft wenig Zeit und Energie, sich in ihrem Umfeld sozial und als Bürger zu engagieren. Auf solches Engagement aber kann eine Gesellschaft nicht verzichten. Mobilität kann die Entwicklung der Bürgergesellschaft beeinträchtigen. Weitere gesellschaftliche Kosten hoher Mobilität sind natürlich die Umweltbelastung und der Ressourcenverbrauch.
Wer viel unterwegs ist, hat zudem wenig Zeit, Kinder großzuziehen.
Das gilt vor allem für Frauen, weniger für Männer. Allgemein zeigen unsere Befunde, dass sich erhöhte Mobilitätserfordernisse negativ auf die Geburtenrate und die Geschlechtergerechtigkeit auswirken können. Zum einen haben wir festgestellt, dass Frauen, deren Männer mobil sind, die gesamte Hausarbeit übernehmen, während das umgekehrt nicht der Fall ist. Das heißt, mobile Frauen sind mit Haushalt, Beruf und Mobilität dreifach belastet. Zum anderen lassen sich Mobilität und Elternschaft für Frauen offenkundig nicht miteinander vereinbaren. Das heißt, entweder bleiben sie kinderlos und können mobil sein oder sie werden Mütter und sind nicht mobil – mit ungünstigen Folgen für ihre Berufsaussichten.
Wie wirkt sich Mobilität auf die Gesundheit aus?
Es wäre falsch zu sagen, wer mobil ist, wird krank. Aber Mobilität birgt erhöhte Risiken. Ob sie eintreten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wer zum Beispiel mobil wird, weil er das will und die Art der Mobilität beeinflussen kann, für den ist das Krankheitsrisiko gering. Wer dagegen mobil sein muss, weil der Arbeitgeber es fordert, und wenig Kontrolle über das Mobilitätsgeschehen hat, hat erhöhte Stressrisiken – zum Beispiel wenn der Zug Verspätung hat oder ein unerwarteter Stau auf der Autobahn entstanden ist. Wenn droht, dass man zu spät kommt, dann entstehen immer wieder extreme Stressspitzen. Der zweite Punkt: Das Krankheitsrisiko sinkt, wenn es Menschen gelingt, die Mobilitätszeiten sinnvoll zu nutzen – zum Beispiel für Entspannung oder Fortbildung. Wem das nicht gelingt und wer die Zeit für Mobilität als verlorene Lebenszeit empfindet, der ist einem höheren Risiko ausgesetzt.
Das klingt, als sei es weniger gesundheitsschädlich, mit der Bahn mobil zu sein als mit dem Auto.
Das stimmt so nicht. Die Zeit im Auto wird gewissermaßen als Privatsphäre erlebt. Mit dem Auto ist man ein bisschen unabhängiger: Man muss nicht um 7:25 Uhr zum Zug, sondern kann auch fünf Minuten früher oder später los. Damit erhält man ein Stück Kontrolle über die Mobilität. Wer dagegen täglich in überfüllten, lauten und schmutzigen Vorortzügen unterwegs sein muss, erlebt das per se als Belastung. Die Wahl des Verkehrsmittels hat statistisch keinen Einfluss auf das Stressempfinden.
Wie muss Mobilität gestaltet sein, um gesellschaftliche und gesundheitliche Schäden möglichst klein zu halten?
Es muss eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie viel Mobilität eigentlich erforderlich ist. Die Unternehmen müssen sich fragen, wie viel Mobilität den Beschäftigten zugemutet werden kann. Und sie müssen Bedingungen dafür schaffen, dass ihre Mitarbeiter gut mit der Mobilität zurecht kommen. Dazu gehört vor allem, ihnen mehr Kontrolle zu geben – zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten, so dass man keine Angst mehr haben muss, zu spät zu kommen. Bei Wochenendpendlern haben wir festgestellt, dass das Stressempfinden linear sinkt, je früher sie am Freitag nach Hause fahren können. Nachdem Mobilität in den vergangenen zwanzig Jahren so gefeiert wurde, wird das Pendel wieder etwas zurückschlagen. Andere Werte wie Loyalität, Erfahrung und Betriebsbindung, die zuletzt vollkommen bedeutungslos waren, werden in den nächsten Jahren wieder wichtiger werden, so dass wir wieder ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit bekommen.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
Norbert F. Schneider ist Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden sowie Professor für Soziologie an den Universitäten Mainz und Wien. Von 2006 bis 2008 hat er ein Forschungsprojekt über die Auswirkungen von Berufsmobilität in sechs europäischen Ländern geleitet.