Der Weg zu Alfred Dagadwa führt durch enge Gassen. Der Abstand zwischen den rissigen Lehmmauern ist kaum breiter als die eigenen Schultern. In der Mitte der Gassen fließt ein schmutziges Rinnsal, auf dem ölige Flecken schimmern. Um nicht in die graue Brühe aus Abwaschwasser und dem Inhalt ausgekippter Nachttöpfe zu treten, eilen die Menschen breitbeinig wie torkelnde Seemänner über die Ränder der ausgetretenen Wege.
Autor
Klaus Sieg
ist freier Journalist in Hamburg und berichtet aus aller Welt über Landwirtschaft, Ernährung, Ökologie, Soziales und Entwicklung.Auch Alfred Dagadwa hat diesen Gang. Lächelnd streckt er die Hand aus. „Kommen Sie hier entlang.“ Hinter ihm führt eine Sackgasse noch weiter hinein in den Slum. „Das ist mein Gemüsegarten“, sagt Alfred Dagadwa und zeigt auf die Säcke mit Kürbis, Spinat und Kelipflanzen. Dann stellt er eine klapprige Holzleiter an die verbogene Dachkante, von der Regenwasser herunter tropft. Weit überragen die Stengel und Blätter der Kelipflanzen die rostigen Blechdächer, aus denen ein Wald von TV-Antennen zu sprießen scheint.
Alfred Dagadwa klettert hinauf und bricht ein tellergroßes Blatt ab. Es hat ausgeprägte Adern und ist an den Rändern ausgefranst. Die Pflanze ist in der kenianischen Küche weit verbreitet. Das Blattgemüse ist kräftig im Geschmack, nahrhaft und robust. Und es wächst schnell. Alfred Dagadwas Augen leuchten: „Einige werden zweieinhalb Meter hoch.“ Drei Jahre lang kann er die Blätter abbrechen, bei jeder Pflanze etwa zweimal pro Woche. Schnell bilden sich neue. Sie ernähren nicht nur den 35-Jährigen, seine Frau und die drei Kinder. Auch die Nachbarn bekommen regelmäßig etwas ab.
Alfred Dagadwa lebt in Kibera, einem der großen Slums der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Vielleicht lebt hier nicht wirklich eine Million Menschen, wie häufig angegeben wird – aber es sind sehr viele. Kibera liegt an den Gleisen der noch von den Briten gebauten Eisenbahnlinie zwischen der Hafenstadt Mombasa und der ugandischen Hauptstadt Kampala. Der Bahnhof ist nicht weit, um den herum Nairobi damals entstand. Nah ist auch das Zentrum mit seinen neuen Bürotürmen, in dem Kenias wachsende Mittelschicht über die breite Kenyatta Avenue flaniert. Neue Autos und glitzernde Auslagen zeugen von Wirtschaftswachstum und Wohlstand in dem afrikanischen Land.
Die Menschen in Kibera leben zwar dicht an dieser Welt – aber gleichzeitig sehr weit von ihr entfernt. „Im Slum sind alle Ressourcen knapp: Geld, Wasser, Essen und Platz“, sagt Keith Porter von der französischen Hilfsorganisation Solidarité. Projekte zur Ernährungssicherung gebe es meistens auf dem Land, aber selten in städtischen Armutssiedlungen, wo sie ebenso dringend nötig seien. Um das zu ändern, hat die Organisation Menschen in Kibera und einem weiteren Slum Nairobis mit Säcken, Setzlingen und Erde ausgestattet und ihnen die Grundlagen des „urban gardening“ beigebracht.
Seitdem pflanzen die Menschen in Kibera Gemüse und Kräuter, hauptsächlich in Säcken, aber auch in kleinen Beeten am Bahndamm, am Rand von Bolzplätzen oder in den aufgebrochenen Fundamenten zusammengefallener Häuser. Das ähnelt der „urban gardening“-Bewegung in westlichen Großstädten. Mit einem entscheidenden Unterschied: Was in Hinterhofgärten, auf Verkehrsinseln, Brachgrundstücken oder Flachdächern in Berlin, Hamburg, Amsterdam oder New York die Selbstversorgerträume hipper Urbanisten befeuert, sichert in Kenias Hauptstadt die nackte Existenz. „Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren sehr gestiegen, und in unruhigen Zeiten explodieren sie fast“, sagt Alfred Dagadwa. Um die Präsidentschaftswahlen im März herum etwa kamen nur noch sehr wenige Händler nach Kibera. Sie fürchteten Unruhen und Ausschreitungen, wie es sie bei den Wahlen vor fünf Jahren gegeben hatte. Die Gewalt blieb zwar aus. Die Preise stiegen trotzdem. Ein Kohlkopf kostete umgerechnet zwei Euro. „Schon in normalen Zeiten spare ich durch den Anbau von Gemüse mindestens 500 Schilling im Monat“, sagt Alfred Dagadwa. Das sind umgerechnet knapp fünf Euro. Dafür muss der Familienvater mindestens einen ganzen Tag arbeiten – wenn er denn Arbeit findet. Zwar wartet er fast täglich an einem der bekannten Treffpunkte auf den Arbeitsvermittler. Aber selbst in guten Monaten klettert er höchstens zehn Mal auf die Ladefläche des klapprigen Lastwagens, der ihn auf irgendeine Baustelle der Metropole karrt.
Die Pflanzen gedeihen auch mit wenig Wasser
Vor drei Jahren hat Alfred Dagadwa mit drei Säcken angefangen. In der Mitte der ausrangierten Reis- oder Zuckersäcke hat er eine kleine Säule aus Steinen geschichtet und den Platz darum mit Mutterboden aufgefüllt. Die Drainage ermöglicht den sparsamen Einsatz von Wasser. „Selbst in der Trockenzeit genügen täglich fünf Liter pro Sack.“ Wasser ist teuer in Kibera. An den von der Stadt gelieferten Tanks stehen die Menschen mit gelben 20-Liter-Kanistern Schlange, um sie für jeweils fünf Eurocent zu füllen. Oft aber gibt es dort kein Wasser mehr und sie müssen bei privaten Händlern den drei- bis vierfachen Preis bezahlen. Das Abwasser, das durch die offenen Kanäle und Gassen des Viertels fließt, ist zu schmutzig.
Die Setzlinge seiner Pflanzen steckt Alfred Dagadwa nicht nur in die obere Öffnung des Sackes, sondern auch in kleine Löcher an den Seiten, die er mit dem Messer hineinschneidet. Aus allen Öffnungen strecken sich die Kelipflanzen der Äquatorsonne entgegen. In einen 50-Kilogramm-Sack pflanzt Alfred Dagadwa so viel wie auf einem Beet von vier bis fünf Quadratmetern. „Wo sollte ich so ein Beet hier anlegen?“ Jeder Quadratmeter wird in Kibera genutzt. Und bezahlt. Für sein zehn Quadratmeter großes Haus muss Alfred Dagadwa umgerechnet um die zwanzig Euro im Monat berappen. Die bekommt sein Slumlord. Die Vorfahren dieses alteingesessenen Bewohners von Kibera hatten das Land noch von den Briten zugeteilt bekommen, als Belohnung für ihren Kampfeinsatz im Zweiten Weltkrieg. Alfred Dagadwa ist erst vor fünfzehn Jahren aus seinem Dorf nach Nairobi gezogen. Nur in Kibera kann er sich eine Bleibe leisten. Die Slumlords holen so viel wie möglich aus ihren Grundstücken heraus. Sie bauen so eng, dass von oben kaum die Gassen zwischen den Blechdächern der Häuser zu sehen sind. Alle zwei bis drei Meter führt eine grobe Holztür direkt in das Haus einer Familie. Im Inneren findet alles in einem Raum statt. Jacken, Hosen und Schuluniformen hängen über Leinen an den Wänden. Die Schlafmatratzen sind zu einem Sofa zusammengeschoben. In einer Ecke steht ein Gaskocher, auf dem Bord darüber Töpfe, Teller und ein Fernseher. Bewegt sich einer, müssen sich alle bewegen.
Die gemeinsame Arbeit stärkt die Nachbarschaft
Vor der Tür funktioniert es nicht anders. Platz für seine 20 Säcke mit den Pflanzen findet Alfred Dagadwa nur, weil er sie die Gasse entlang an die Hausmauern stellt. Deshalb muss er auch seine Nachbarn mit Gemüse versorgen: „Ich pflanze direkt vor ihrer Tür, da kann ich es ihnen ja schlecht verkaufen.“ Zu seinem Bedauern aber ist Alfred Dagadwa der Einzige, der sich um die Pflanzen kümmert; er tauscht zerschlissene Säcke aus, reichert die Erde mit Kompost an, gießt die Pflanzen oder schneidet sie zurück. Außerdem mischt er ein Pflanzenschutzmittel aus Knoblauch, Neem und Chilis an. „Viel Arbeit für einen alleine.“ Den Anbau von Tomaten hat Alfred Dagadwa deshalb wieder aufgegeben.
Rosmari Ayuma und ihre Nachbarinnen haben das besser gelöst. „Wir kümmern uns gemeinsam um die Säcke“, sagt die 40-jährige Mutter von fünf Kindern. Ihr Garten gewinnt sicherlich keinen Schönheitspreis. Abfall liegt zwischen den Säcken herum, die an einer Weggabelung stehen. Doch leben fünf Familien von der urbanen Gartenaktivität Rosmaris und ihrer Nachbarinnen. Keli, Zwiebeln, Chilis, Spinat und Kohl bauen sie an. „Unser Speiseplan hat sich sehr verbessert, vor allem die Kinder litten vorher an den Folgen von Unterernährung.“ Die gemeinsame Arbeit hat die Nachbarschaft gestärkt. Manchmal verkaufen die Frauen sogar Gemüse aus ihrer Produktion. Ein dauerhaftes Einkommen können sie aber nicht erwirtschaften – es wird zuviel gestohlen. An den Säcken kommen täglich viele Menschen vorbei. Das Gemüse weckt Begehrlichkeiten in einer so bitterarmen Gegend.
Die Müllhalde hat sich in einen Garten verwandelt
Mit Diebstahl und Vandalismus haben zum Teil auch die von Solidarité organisierten Gartengruppen zu kämpfen. Auf Beeten und Feldern oder in Gewächshäusern produzieren sie am Rand des Slums Setzlinge oder Heilkräuter, pflanzen Zuckerrohr und Neembäume, stellen Kompost her und veranstalten Kurse. Nicht selten werfen Jugendliche mit Steinen die Plastikplanen der Gewächshäuser ein. Häufig werden Draht und Bleche der Umzäunung geklaut und beim nächsten Schrotthändler verkauft. Die Slums von Nairobi sind ein heißes Pflaster. Viele der jungen Männer sind bewaffnet und in Gangs organisiert. Aber selbst einige von ihnen haben neuerdings das „urban gardening“ für sich entdeckt, in Mukuru, dem anderen großen Slum in Nairobi. Er liegt in einem Industriegebiet, umgeben von qualmenden Fabrikschloten, Lagerhallen und vierspurigen Ringstraßen. Hier ist es noch enger als in Kibera. Jackson Osore und Zakario Obala sind in Mukuru aufgewachsen. Seit kurzem beackern sie mit 20 anderen jungen Männern einen Garten von der Größe eines Handballfeldes am Rand der Siedlung. Neben Keli und Spinat pflanzen sie Zuckerrohr, Bananen und Amarant. Als Zaun haben sie alte Autoreifen aufeinander gestapelt. Zur anderen Seite begrenzt ein verdreckter Fluss das Gelände. Zwei ältere Männer stehen bis zu den Hüften in dem schwarzen Wasser und suchen mit bloßen Händen nach Altmetall.
„Das war eine Müllhalde hier, wir haben tagelang geschuftet, um das Gelände frei zu bekommen“, erklärt Jackson Osore. Zakario Obala nickt: „Als Jackson mit der Idee ankam, wusste ich: Das ist die Gelegenheit, mein Leben zu ändern.“ Bis dahin hatte sich der 24-Jährige mit Raub, Diebstahl und Drogenhandel über Wasser gehalten. Wie viele andere aus der Gartengruppe hat er mittlerweile seine Waffe bei der Polizei abgegeben. Zwar sind viele der jungen Männer immer noch ohne Arbeit. Aber mit dem Verkauf der Lebensmittel verdienen sie ein wenig Geld, steuern etwas zur Ernährung ihrer Familien bei und sind beschäftigt. „Mit dem Garten geben wir unserer Community etwas zurück“, sagt Zakario Obala und fährt sich mit dem Zeigefinger über eine Narbe auf seiner Wange. Sie sorgen also für große Veränderungen, die kleinen Gärten in den Slums von Nairobi.

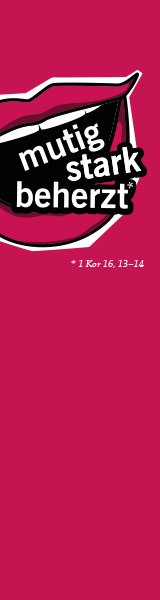
Neuen Kommentar hinzufügen