In armen Ländern haben viele Menschen keinen Zugang zu guten Gesundheitsdiensten, oder kulturelle oder andere Barrieren hindern sie daran, sich im Krankenhaus oder in Gesundheitsstationen behandeln zu lassen. So kommt es vor, dass gut ausgestattete Krankenhäuser nicht ausgelastet sind. Auch bei der Suche nach Fachkräften stoßen Kliniken in Entwicklungsländern auf Probleme. Und Fachleute in der Entwicklungszusammenarbeit machen die Erfahrung, dass Basisgesundheitsprogramme oft nur so lange funktionieren, wie sie von außen mitgetragen werden.
Autorin
2008 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deshalb das Difäm und andere Organisationen beauftragt, einen Ansatz zu erarbeiten, der die Menschen vor Ort stärker einbindet und in die Pflicht nimmt. „Uns ist wichtig, dass wir auf dem aufbauen, was bereits im Gesundheitsbereich vorhanden ist", sagt Gisela Schneider, die Direktorin des Difäm. Das können bereits fertige Einrichtungen sein, aber auch Gruppen oder Personen, die sich in ihrer Gemeinschaft engagieren und für Gesundheitsfragen offen sind.
Krankenhauspersonal muss sich zuhause fühlen, damit es bleibt
Der sogenannte Asset-Ansatz wolle die lokalen Ressourcen besser nutzen, sie miteinander vernetzen und damit die Verantwortung für den Gesundheitsbereich stärker auf Gemeindeebene verankern. „Welchen Bedarf die Menschen vor Ort haben, können wir nicht von außen vorgeben. Das muss schon von ihnen selbst kommen", sagt Schneider, die selbst als Ärztin insgesamt 23 Jahre lang in Afrika und Asien gearbeitet hat. Wenn zum Beispiel viele Frauen zur Entbindung nicht ins Krankenhaus gingen, müsse darüber nachgedacht werden, wie eine Geburtsstation ausgestattet und geführt werden muss, damit die Frauen sie als bessere Alternative zur üblichen und oft auch risikoreichen Hausgeburt in Betracht ziehen.
Oder wenn in einem Krankenhaus frustriertes Personal arbeite, das darauf warte, endlich wieder eine Stelle in der Stadt zu bekommen, müsse man gemeinsam mit den Menschen vor Ort überlegen, wie man sie besser motivieren könne. „Manchmal hilft es schon, wenn sich Leute aus der Gemeinde in den Gesundheitseinrichtungen um Sauberkeit kümmern oder sich die Gemeinde bereit erklärt, für mehr Sicherheit für die Mitarbeitenden zu sorgen", sagt Schneider. Die Menschen vor Ort müssten das Krankenhaus als ihre eigene Einrichtung annehmen. Auf der anderen Seite wäre es begrüßenswert, wenn die Mitarbeitenden im Krankenhaus sich als Teil der Gemeinde begriffen.
In den Hilfswerken wird die Arbeit des Difäm mit Interesse verfolgt. „Der Basisgesundheitsansatz ist für unsere Partner, die im Gesundheitsbereich arbeiten, zentral", sagt Sonja Weinreich, die beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) für den Arbeitsbereich Gesundheit zuständig ist. Der EED prüft nun, inwieweit er in Projekten im Gesundheitsbereich den neuen Ansatz des Difäm anwenden kann.
Das Difäm will noch im Sommer mit einem Pilotprojekt in Malawi starten. In zwei Gesundheitseinrichtungen soll erprobt werden, ob sich mit dem partizipativen Ansatz die bisher geringe Auslastung und die Qualität der Versorgung steigern lässt. In Workshops soll erarbeitet werden, was von lokaler Seite aus für eine bessere Auslastung beigetragen werden kann. Es gehe darum, dass Menschen ihre Einstellung zum Thema Gesundheit ändern, sagt Schneider. Nach drei Jahren will das Difäm das Projekt evaluieren. Anhand von Indikatoren wie der Anzahl der Behandlungen oder der Frauen, die stationär entbinden, soll gezeigt werden, ob der Ansatz erfolgreich ist. Finanziert wird das Pilotprojekt von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und dem Difäm.
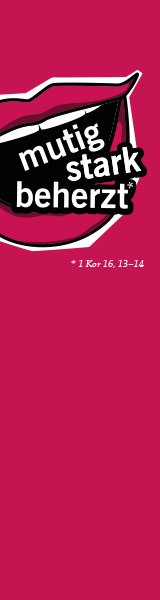
Neuen Kommentar hinzufügen