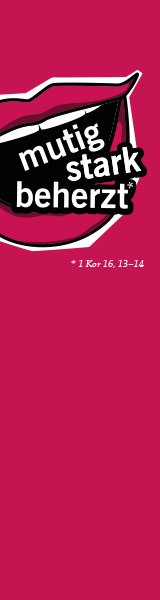Ihr aktuelles Buch „Big Chiefs“ handelt von korrupten Machtstrukturen und ethnischen Konflikten. Es gibt mehrere Anspielungen auf den Genozid in Ruanda 1994. War er der Anlass für das Buch?
Nein. Ich möchte klarstellen, dass mein Buch nicht vom Genozid in Ruanda handelt und sich generell nicht auf konkrete Ereignisse bezieht, auch wenn es Ähnlichkeiten mit konkreten Ereignissen gibt. Vor 30 Jahren begann ich damit, Essays zu schreiben, die von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in ganz Afrika beeinflusst waren. Daraus ist letztlich „Big Chiefs“ entstanden. Vor ein paar Jahren war ich in Ruanda und habe Schauplätze des Genozids besucht. Darüber wollte ich schreiben, aber die Eindrücke haben mich zu sehr beeindruckt und bewegt. Es war diese Erfahrung einer Gesellschaft, die sich über lange Zeit selbst zerstört hat. Mir wurde bewusst, dass ich nicht konkret über diesen Genozid schreiben konnte. Dann entwickelte ich die zwei Hauptfiguren von „Big Chiefs“ und integrierte die älteren Essays.
In dem Buch wird eine korrupte Elite beschrieben, die nur allgemein als „Chiefs“ bezeichnet wird. Weshalb dieser Begriff?
Der Chief ist das Oberhaupt, er ist der Anführer der Gruppe. Im Buch soll es ganz allgemein um Personen gehen, die die Macht inne haben – unabhängig von der Ebene.
Kann „Big Chiefs“ auch als Warnung an Ihr Heimatland verstanden werden, wo der Machtkampf innerhalb der mühsam etablierten Regierung anhält?
Jeder kann das Buch lesen und interpretieren, wie er möchte. Wichtig ist mir nur die Feststellung, dass es nicht um Auseinandersetzungen zwischen Volksgruppen geht, sondern um Machtkämpfe auf politischer Ebene. Und die „Big Chiefs“ haben eine Sache gemeinsam – unabhängig von ihrer Volksgruppe, Hautfarbe oder was auch immer: Sie wollen an der Spitze stehen und herrschen. Mein Buch kann also allgemein als Warnung verstanden werden, was passieren kann, wenn persönliche Interessen die Politik bestimmen. Bei den Unruhen in Kenia nach den Wahlen im Dezember 2007 handelte es sich ja in Wirklichkeit auch einfach um politische Machtkämpfe und nicht um Konflikte zwischen Volksgruppen. Ethnizität spielt genau dann eine Rolle, wenn die politischen Kontrahenten Unterstützung benötigen.
Wie war die Resonanz auf das Buch in Kenia?
Das Buch ist seit Anfang 2009 in Kenia auf dem Markt. Es gab ein paar positive und ein paar verhaltene Rezensionen dazu. Aber es ist schwierig zu sagen, wie meine Landsleute das Buch aufnehmen, weil sich Bücher bei uns sehr langsam verbreiten. In der derzeitigen politischen Situation in Kenia haben viele Leute andere Sorgen als mein Buch.
Die BBC hat im Oktober gemeldet, dass die Volksgruppen der Kikuyu und Kalenjin neue Waffen kaufen, weil sie jeweils Übergriffe der Gegenseite befürchten. Was haben Sie in Nairobi davon mitbekommen?
Ich habe das bisher auch nur auf BBC gehört. Ich war genauso überrascht wie alle anderen in meinem Umfeld und hoffe, dass es nicht stimmt. Das Problem ist, dass in Kenia alles ethnisch interpretiert wird. Wenn beispielsweise in einer ländlichen Region das Wasser knapp wird und es über die Nutzung Streit gibt, verläuft dieser Streit zwischen den Volksgruppen. Solche Spannungen werden dann schnell als ethnische Konflikte dargestellt. Ausländische Medien sind da den kenianischen sehr ähnlich, alle benutzen die gleiche Terminologie.
Bei Wahlen ist es ebenfalls in der Regel so, dass die Volksgruppen einen Kandidaten oder eine Partei ihrer Gruppe unterstützen. Fühlen sich die Wahlsieger dann vor allem ihrer Volksgruppe verpflichtet und versuchen, für sie den größten Nutzen zu erzielen?
Ja, absolut. Es geht immer darum, die Interessen der eigenen Gruppe zu schützen. Und weil sich diese Gruppen bei uns so leicht einteilen lassen, benutzen die intelligenten Politiker die weniger gebildeten, einfachen Leute für ihre Ziele. Dann passiert es sehr schnell, dass sich zwei wütende Mobs gegenüberstehen und aufeinander losgehen.
In Ihrem Buch „Happy Valley“ hat der Chief in einer dörflichen Gemeinschaft das Sagen. Inwiefern bestehen diese Strukturen in Kenia noch, wie viel Macht haben die Chiefs?
Anders als in meinem Buch ist es heute in den Volksgruppen, die ich kenne, nicht mehr so, dass die Position des Chiefs vererbt wird. Schon mit Einführung der indirekten Herrschaft in der Kolonialzeit hat die Kolonialverwaltung viele traditionelle Chiefs durch andere ersetzt, die gleichzeitig den Verwaltungsbezirk geleitet haben und somit Angestellte der Kolonialverwaltung waren. Kenia hat das aus der Kolonialzeit übernommen und es ist noch heute so. Die Angestellten auf lokaler Ebene nennen wir „Government Chiefs“. Sie können sich um den Job bewerben. Wie auch ihre Vorgesetzen in der Verwaltung auf Distrikt- und Provinzebene werden die Bewerber dann aber nicht gewählt, sondern von höherer Stelle ernannt.
Wer hat die besten Chancen auf solch einen einflussreichen Job?
Die aussichtsreichsten Bewerber sind jene, die einen einflussreichen, wohlhabenden Hintergrund haben und aus entsprechenden Familien kommen. Das verringert die Gruppe jener, die ein politisches Amt erringen können. Und es entsteht eine Struktur der Abhängigkeiten von der obersten zur untersten Ebene. Das ist dann zwar ein System fürs Herrschen, aber nicht fürs Regieren. Da wird Macht verliehen, ohne dass Rechenschaftspflicht besteht. Wenn diese Leute dann von Benachteiligten oder Einheimischen kritisiert werden, fühlen sie sich schnell angegriffen und betrachten die Kritiker als Dissidenten oder politische Feinde.
Vor gut zehn Jahren haben Sie in einem Interview gesagt, dass die Meinungsfreiheit in Kenia garantiert ist. Ist das heute immer noch so oder gibt es Formen von Zensur oder Selbstzensur?
Die Meinungsfreiheit ist immer noch gegeben und es gibt deutlich mehr Informationen als vor 1998. Ich kann auch nicht feststellen, dass die Leute sich in letzter Zeit mehr zurücknehmen mit ihrer Meinung, weil sie Repression fürchten.
In Ihren Büchern tun oft die Frauen das richtige und behalten den Überblick. Bräuchte Kenia mehr Politikerinnen, damit die politische Klasse sich ändert?
Das könnte uns gut tun. Es erscheint mir oft so, dass bei Frauen das Mitgefühl und andere Werte stärker ausgeprägt sind, während Männer aggressiver sind, sich profilieren wollen und vor allem um Macht kämpfen.
Das Gespräch führte Felix Ehring.
Meja Mwangi gehört zu den bekanntesten Schriftstellern Ostafrikas. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Er lebt in der kenia-nischen Hauptstadt Nairobi.