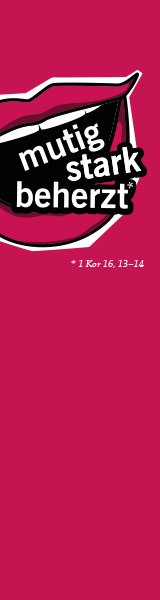Seit Jahren herrscht in der Demokratischen Republik Kongo ein blutiger Krieg mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Die Kongolesin Monique Mbeka Phoba hat mehrere Dokumentarfilme über die Menschen in ihrem Land gemacht. Sie erzählt, wie schwierig das ist – und warum es ihr trotzdem am Herzen liegt.
Sie sind 1962 als Diplomatentochter in Brüssel geboren. Bevor sich Ihr Vater von Mobutu distanzierte, war er ein wichtiger Politiker im Kongo. Sie müssen aus einer privilegierten Familie stammen.
Ja, das stimmt. Wir waren sehr privilegiert. Bei der Unabhängigkeit 1960 gab es weniger als zehn Kongolesen, die studiert hatten. Mein Vater war einer davon. Selbst Patrice Lumumba, der erste Premierminister des Landes, hatte nur eine Ausbildung als Buchhalter. Während der Kolonialzeit haben die Belgier wirklich alles unternommen, um die Kongolesen zu demütigen. Zum Beispiel ließen sie sie nicht studieren. Erst Ende der 1950er Jahre wurden seltene Ausnahmen gemacht. Ansonsten war die Universität den Belgiern vorbehalten. Ich bin allerdings in zweifacher Hinsicht privilegiert gewesen. Mein Großvater war von Beruf Medizinassistent und gehörte deswegen zu den so genannten registrierten Kongolesen.
Was bedeutet das?
„Registriert“ war ein offizieller Status unter den Belgiern. Die registrierten Kongolesen durften sich an Orten aufhalten, die eigentlich den Weißen vorbehalten waren. Um zu dieser Schicht zu gehören, musste man eine Prüfung ablegen und zum Beispiel zeigen, dass man mit Messer und Gabel essen konnte oder die Ehefrau Unterwäsche trug.
In Ihrem Film „Un rêve d’indépendance“ (Unabhängigkeit – ein Traum) von 1997 zeichnen Sie das Leben Ihres Großvater nach. Warum haben Sie ihn in den Mittelpunkt eines Dokumentarfilms gestellt?
Dieser Film dokumentiert nicht nur das Leben meines Großvaters sondern auch die Entwicklung des Gesundheitssektors insgesamt. Während der Kolonialzeit gab es nur weiße Ärzte. Die Einheimischen durften allenfalls Medizinassistent werden – eine Berufsbezeichnung, die die Belgier extra für die Kongolesen erfunden hatten, um ihnen den angesehenen Status eines Arztes vorenthalten zu können. Die Medizinassistenten machten die gleiche Arbeit wie die Ärzte, aber sie durften sich nicht so nennen.
Und nach der Unabhängigkeit?
In den 1950er Jahren gab es im Kongo 900 ausgewanderte Ärzte. Als die Belgier das Land verließen, blieben nur noch 20. Stellen Sie sich das vor: 20 Ärzte für ein Land, das fast sieben Mal so groß ist wie Deutschland! Die Weltgesundheitsorganisation schlug damals auf Anraten der Belgier den kongolesischen Medizinassistenten vor, in Europa weiterzustudieren, um dort den Abschluss als Arzt nachzuholen. Viele haben das gemacht, sind nach Frankreich oder Belgien gegangen und haben sich dafür zum Teil massiv verschuldet. Mein Großvater hatte sein Leben lang davon geträumt, Arzt zu sein. Er ist schließlich nach Nantes gegangen und hat mit fast 50 Jahren noch einmal mit dem Studieren begonnen. Mit 56 durfte er sich endlich Arzt nennen, obwohl er über viele Jahre hinweg bereits wie ein Arzt gearbeitet hatte. Kurz darauf ist er leider gestorben.
Was sagt die Geschichte Ihres Großvaters über den Kongo?
Wie viele andere hat mein Großvater immer davon geträumt, etwas aus sich zu machen. Und als es endlich möglich war, hat er auch alles darangesetzt, um seinen Traum wahr werden zu lassen. Ich bin sehr stolz auf meinen Großvater, der in dem Alter noch einmal ein Studium begonnen hat. Seine Botschaft lautet: Man muss an seine Träume glauben.
Aber heute, 48 Jahre nach der Unabhängigkeit, steht der Kongo für Krieg, Elend und Ungerechtigkeit.
Ja, und was im Kongo seit der Unabhängigkeit geschehen ist, kann man nur als eine enorme Verschwendung bezeichnen, eine Verschwendung von Menschen und von Ressourcen. Mein Großvater ist ein Beispiel dafür.
Eine ziemlich deprimierende Botschaft. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu diesem Land beschreiben?
Ich liebe dieses Land. Und zwar für seine Sanftmut. Das mag paradox klingen angesichts dessen, was man in den Medien hört. Aber die Kongolesen sind ein extrem sanftes, herzliches und warmherziges Volk. Sie geben einander, was sie können, auch wenn es nur sehr wenig ist. Ich fühle mich oft sehr durch den westlichen Lebensstil angegriffen. Der Stress, das überrationalisierte Leben. Man hat keine Zeit mehr füreinander. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem solchen Land alt zu werden.
Sie haben neun Filme gemacht, davon vier im Kongo. Welche Rolle spielt das Kino in diesem Land?
Der kongolesische Film kann nicht mit dem anderer afrikanischer Länder wie Burkina Faso, Senegal, Marokko oder Südafrika verglichen werden. Selbst in Benin ist es einfacher einen Film zu drehen. Sobald man die Genehmigung hat, kann man loslegen. Im Kongo dagegen wird das Filmemachen von den Behörden nicht unterstützt. Man braucht von jedem eine Einwilligung und nie ist man sich sicher, dass man wirklich alle Genehmigungen hat. Dazu kommen noch all die Probleme mit der Infrastruktur, die die Arbeit enorm erschweren. Es ist sehr anstrengend, einen Film im Kongo zu drehen.
Warum machen Sie es trotzdem? Sie haben viel Erfolg mit Ihren Filmen in Benin, wo Sie lange Zeit gelebt haben.
Ich möchte die Geschichten der Menschen in diesem Land vor dem Vergessen bewahren. Und in Europa möchte ich mit meinen Filmen die Aufmerksamkeit auf dieses Land lenken. Die Bilder, die man in Europa sieht, sind verzerrt. Wenn ich mit anderen über den Kongo rede, stelle ich oft fest, dass sie praktisch nichts über dieses Land wissen.
In Ihrem Film “Sorcière, la vie!” behandeln Sie das Thema Hexerei. Spielt dieses Thema eine Rolle im Leben der Leute?
Hexerei ist im Kongo ziemlich verbreitet. Aber man muss dieses Phänomen richtig interpretieren. Da gibt es die so genannten Hexenkinder. Sie werden oft von der eigenen Familie der Hexerei beschuldigt. Sie werden getötet oder davonjagt. Alle glauben, das sei Teil einer alten Tradition. Aber im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern gibt es im Kongo das Phänomen der Hexenkinder erst seit den 1990er Jahren.
Wie ist das zu erklären?
Das hängt mit der Wirtschaftslage zusammen. Viele dieser Kinder sind Waisen. Und weil die Menschen immer ärmer werden, wird es immer schwieriger, eine Familie zu ernähren. Waisenkinder aufzunehmen überfordert viele finanziell. Um sich nun dieser Kinder zu entledigen, beschuldigt man sie der Hexerei. Ich mache meine Filme auch, um solche Zusammenhänge aufzudecken.
Der Krieg im Osten des Kongo hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch verschärft. Inwiefern sind Sie von dem Krieg betroffen?
Ich war noch nie im Osten des Landes. Aber das ganze Leben im Kongo ist von diesem Krieg betroffen. Nehmen Sie nur die Wirtschaftslage: Die ist landesweit katastrophal und das betrifft jeden. Die große Frage ist: Wer wird am Ende die Kontrolle über die Minen im Osten haben, die Kongolesen oder die Nachbarländer mit ihren ausländischen Partnern, den Wirtschaftskonzernen? Ohne diesen Krieg hätten wir längst durchgestartet. Es gibt in diesem Land so viele Menschen, die etwas können und ihr Land lieben.
Das Gespräch führte Katja Dorothea Buck.
Monique Mbeka Phoba hat in Brüssel Wirtschaftswissenschaften studiert und ist seit 1991 als Filmemacherin tätig. Sie hat neun Dokumentarfilme gedreht, vier davon im Kongo. Einen, „Sorcière, la vie!“ (2005), hat der EED mitfinanziert.