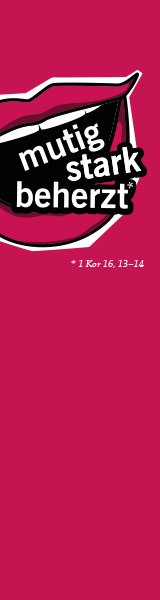Von Tillmann Elliesen
Obamania in Afrika: Sie hoffe, dass die afrikanischen Führer die Chancen nutzen, die der neue US-Präsident ihnen wahrscheinlich eröffnen wird, schrieb die kenianische Umweltaktivistin Wangari Maathai kürzlich in einem Zeitungsartikel. Der Beitrag las sich wie ein Stoßseufzer der Weltbürgerin, die den Frust über die bornierte Außenpolitik der Ära Bush schnell vergessen will und die Wahl des Demokraten mit der kenianischen Großmutter als Zeichen der Hoffnung für ihren Kontinent sieht. Dabei war an der Entwicklungspolitik von George W. Bush manches gar nicht so schlecht. Und sein Nachfolger Barack Obama wird nicht alles anders machen.
Unter Bush hat sich die US-amerikanische Entwicklungshilfe von gut elf Milliarden auf knapp 22 Milliarden Dollar fast verdoppelt – wobei allerdings ein großer Teil des Anstiegs auf Afghanistan und den Irak entfällt. Bush hat zudem eine Reihe neuer Instrumente für die US-Hilfe geschaffen, darunter das Sonderprogramm zur Bekämpfung von Aids
(PEPFAR) und die Millennium Challenge Corporation (MCC), die Geld an ausgewählte Länder mit fähigen und nicht korrupten Regierungen vergibt. Beidem liegen sinnvolle Ideen zugrunde, die aber schlecht verwirklicht wurden: Das Aids-Programm war lange wenig effizient, weil es nur Originalmedikamente von US-Pharmafirmen verwendete und nicht die billigeren Kopien von Generika-Herstellern. Das hat Washington inzwischen korrigiert. Und die MCC-Hilfe für gut regierte Staaten ist bislang viel spärlicher geflossen als versprochen, weil die Auswahl der Kandidaten und die Auszahlung der Mittel so umständlich sind.
Die Regierung Bush hat die Entwicklungspolitik zudem in eine neue außenpolitische Strategie eingebettet, die Außenministerin Condoleezza Rice vor drei Jahren unter der Bezeichnung „transformational diplomacy“ vorgestellt hat. Demnach sollen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik eng miteinander verknüpft werden und den Aufbau stabiler demokratischer Staaten fördern. Auch das ist keine schlechte Idee. Allerdings hat die neue Politik klassische entwicklungspolitische Aufgaben wie Armutsbekämpfung an den Rand gedrängt und die früher weitgehend autonom arbeitende Entwicklungsagentur USAID zu einem verkümmerten Anhängsel des Außenministeriums degradiert.
Barack Obama wird die „Diplomatie für Wandel“ fortsetzen. Er hat angekündigt, die Unterstützung von demokratischen Bewegungen im Ausland auszubauen. Und er will so genannte Mobile Entwicklungsteams einrichten, in denen die Armee sowie Mitarbeiter des Außenministeriums und von USAID in fragilen Staaten zusammenarbeiten. Das wäre nichts anderes als die Globalisierung des Africom-Modells, des neuen Militärkommandos für Afrika, in dem die Armee und zivile Kräfte enger kooperieren als in jedem anderen Regionalkommando.
Aber der neue Präsident wird die Schwerpunkte anders setzen. Unter Bush ist das Verteidigungsministerium zu einem der wichtigsten Spieler in der US-Entwicklungspolitik aufgestiegen: 2005 vergab das Pentagon 22 Prozent der amerikanischen Entwicklungshilfe, sieben Jahre zuvor waren es noch weniger als 4 Prozent. Im selben Zeitraum ist der Anteil von USAID von 64 Prozent auf weniger als 40 Prozent geschrumpft. Obama dürfte diesen Trend wieder umkehren. Im Wahlkampf hat er sich mit Nachdruck für einen Ausbau der „soft power“ ausgesprochen, also der nicht militärischen Machtmittel der USA. Selbst der amtierende Verteidigungsminister Robert Gates, den Obama vorerst im Amt lassen will, hat vor einem Jahr eine „dramatische Erhöhung“ der zivilen Mittel in der Außen- und Sicherheitspolitik gefordert.
Obama hat angekündigt, er werde die vielen Instrumente der US-Entwicklungshilfe unter dem Dach von USAID zusammenführen und die Agentur personell und finanziell stärken. Er wird es aber nicht leicht haben, in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise das dafür nötige Geld aufzubringen. Der künftige
Vizepräsident Joe Biden hat schon in Aussicht gestellt, dass aus der versprochenen Verdoppelung der US-Entwicklungshilfe auf 50 Milliarden Dollar bis 2012 vielleicht nichts wird.
Wangari Maathai tut deshalb gut daran, ihre Begeisterung gleich wieder zu dämpfen: Die Afrikaner dürften nicht erwarten, dass der neue US-Präsident sie füttern, anziehen und ihre Probleme lösen werde, schreibt sie. Sie müssten schon selbst die Ärmel hochkrempeln und das Beste aus der neuen Situation machen.