Jeffrey Smith war klar, dass er am 1. Dezember nicht viel Schlaf bekommen würde. Der Menschenrechtsaktivist saß die ganze Nacht vor seinem Computer in Washington und verfolgte die Auszählung der Stimmen in Gambia. Freiwillige in Banjul, der über 6500 Kilometer entfernten Hauptstadt des westafrikanischen Landes, mailten ihm die einlaufenden Ergebnisse der Wahlkreise. Es war eine entscheidende Wahl: Yahya Jammeh, Gambias exzentrischer Präsident, der das Land seit 22 Jahren autokratisch regierte, stand einem überraschend starken Herausforderer namens Adama Barrow gegenüber. Der sanftmütig wirkende Immobilienhändler war noch wenige Monate zuvor kaum bekannt gewesen.
Gegen fünf Uhr morgens zeichnete sich ein unerwarteter Sieg für Barrow ab, der jahrzehntelange staatliche Repressalien und Menschenrechtsverletzungen beenden könnte. Und tatsächlich: Am Ende der Auszählung hatten Barrow 43,3 Prozent und Jammeh 39,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.
Barrows Sieg war auch ein Triumph für Smith. Neun Monate zuvor hatte er in Washington gemeinsam mit Joe Trippi, einem Strategen der Demokratischen Partei, und Christopher Harvin vom PR-Unternehmen Sanitas International die gemeinnützige Organisation Vanguard Africa aus der Taufe gehoben. Sie unterstützt Politiker in Afrika, die für Demokratie eintreten. Dabei ermöglicht sie auch politischen Außenseitern jene Art von Öffentlichkeitsarbeit, die sonst Autokraten vorbehalten ist, die das nötige Geld haben, ihr Image von ausländischen Unternehmen aufpolieren zu lassen.
„Hier in Washington gibt es so viele PR-Agenturen und Lobbyisten, die für repressive Regime arbeiten. Denen helfen sie, sich ein positives Image zuzulegen, auch wenn sie die Menschenrechte missachten“, sagt Smith. Der 36-Jährige hat zu afrikanischen Ländern bereits für die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco), für die Menschenrechtsorganisation Robert F. Kennedy Human Rights sowie für die Denkfabrik Freedom House gearbeitet hat. Gegenwärtig stützt sich Vanguard Africa hauptsächlich auf die Mittel seiner Gründer. Sie hoffen, bald auch Geld von Familienstiftungen und Unternehmen zu erhalten, um „demokratischen Außenseitern“ auf dem afrikanischen Kontinent kostenlos Hilfe anbieten zu können.
Mögliche Gegegenkandidaten beraten
Im Vorfeld der Wahl in Gambia beriet die Organisation Kandidaten, die es wagten, gegen Jammeh anzutreten, in Sachen Wahlkampf und Öffentlichkeitsarbeit. Jammeh war 1994 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Menschenrechtsorganisationen werfen seiner Regierung vor, Oppositionelle, Journalisten und Angehörige der LGBT-Gemeinde festzunehmen und zu foltern. Smith knüpfte Kontakte zu internationalen Journalisten, damit sie über die Wahl in Gambia berichteten, verbreitete über soziale Medien die Namen der Kandidaten und informierte regelmäßig in Nachrichtensendungen über das Thema.
Während die Menschen auf den Straßen von Banjul den Wahlsieg von Barrow feierten, kamen über Twitter Dankesnachrichten an Smith und Vanguard herein. „Herzlichen Dank an Jeffrey Smith, einen wahren Freund Gambias“, lautete ein Tweet: „Viele haben uns links liegenlassen, aber du warst immer an unserer Seite.“ Auch wenn Smith versuchte, die Aufmerksamkeit auf die Leistung der gambischen Wähler zu lenken, rückten die Medien vor allem Vanguard ins Rampenlicht. Manche stellten seine Motive in Frage. „Wir sollten uns vor allem fragen, wer @Smith_JeffreyT eigentlich ist und weshalb ihn unser Schicksal interessiert“, twitterte jemand. Er steht für eine Minderheit. Doch die Skepsis, die er ausdrückt, zeigt auch, dass es für Vanguard nicht einfach ist, Demokratie von der anderen Seite des Globus aus zu unterstützen.
Dennoch könnten nichtstaatliche Organisationen wie Vanguard derlei Aufgaben unter der neuen US-Regierung stärker wahrnehmen als bisher. Denn die scheint entschlossen, Amerikas Engagement im Ausland zurückzufahren. In seiner Antrittsrede hat Donald Trump erneut die Parole „America First“ ausgegeben. Gut möglich also, dass die USA der bislang traditionellen Förderung demokratischer Bestrebungen in anderen Ländern fortan weniger Gewicht beimessen.
Steven Feldstein, der für das zum US-Außenministerium gehörende Amt für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit tätig ist, meint: „Leute, die sich für Demokratie engagieren, sind gerade sehr verunsichert, wie es weitergeht.“ Dennoch würden diese Organisationen ihre Arbeit in den USA wahrscheinlich fortsetzen. Gruppierungen wie das Nationale Demokratische Institut, die Regierungsgelder für Demokratieförderung erhalten, haben seit jeher die Unterstützung von Politikern beider Parteien; andere sind privat finanziert.
Prodemokratische Gruppen in Afrika stärken
Autokratische Regierungen in Afrika hielten sich oft mit Hilfe von Geld, Bestechung und Beschneidung von Informationsmöglichkeiten an der Macht, sagt Feldstein. Deshalb könnten Oppositionsparteien ohne Hilfe von außen kaum einen tragfähigen Wahlkampf auf die Beine stellen. „Die Arbeit, die Vanguard leistet, schafft einen Ausgleich, denn sonst begünstigen alle Umstände die Amtsinhaber“, sagt er.
Viele dieser prodemokratischen Gruppen engagieren sich in Afrika, wo die Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte gemacht hat. Doch die Aufgaben bleiben groß: 2015 bemühten sich die Staatschefs von Ruanda, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo, die Begrenzungen ihrer Amtszeit aufzuheben, und 2016 überschatteten Gewalt und Korruption die Wahlen in Uganda, Somalia und Gabun.
Barrows überraschender Wahlsieg brachte das kleine Land Gambia, das nur 1,8 Millionen Einwohner zählt, über Nacht in die internationalen Schlagzeilen. Zunächst räumte Präsident Jammeh seine Niederlage ein, aber zweifelte nach einer Woche dann doch das Wahlergebnis an und forderte einen neuen Urnengang. Als die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) mit einer Intervention drohte, falls Jammeh nicht freiwillig gehe, verließen Tausende Gambier fluchtartig das Land. Auch Barrow brachte sich im Senegal in Sicherheit, wo er am 19. Januar in der Hauptstadt Dakar als neuer Präsident Gambias vereidigt wurde.
Am 21. Januar marschierten Soldaten westafrikanischer Staaten in Gambia ein, um einen friedlichen Machtwechsel zu sichern. Jammeh gab auf und ging nach Äquatorialguinea ins Exil. Zum Leidwesen vieler Gambier nahm er seine Sammlung von Luxusautos mit. Doch es war die erste unblutige Machtübergabe seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1965. Hunderte Gambier kehrten erleichtert in ihre Heimat zurück.
Im Gespräch mit „Newsweek“ sagt Barrow, er begrüße Hilfe von außen zum Aufbau der Demokratie in Gambia. „Wir wollen Demokratie, Menschenrechte und das Gesetz verteidigen“, erklärt er. Er hofft, an Beziehungen zum Ausland anzuknüpfen, die unter Jammeh gelitten haben. So hatten die USA Gambia von einigen Hilfsprogrammen und Handelserleichterungen ausgeschlossen. „Wir haben keine natürlichen Rohstoffe, die Wirtschaftslage ist sehr, sehr ernst. Wir brauchen die Hilfe aller Gambier und Freunde Gambias, damit das Land wieder auf die Beine kommt“, sagt Barrow.
Die Gründer von Vanguard wollen dafür sorgen, dass mehr Politiker wie Barrow eine Chance haben, an die Regierung zu kommen. „Es wird viel Geld zur Bekämpfung von Aids und Malaria gespendet, und ein großer Teil davon wandert in die Taschen korrupter Staatsführer“, sagt Joe Trippi, ein führendes Mitglied von Vanguard. Als Wahlkampfberater hatte er sich außer für die demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Howard Dean und John Edwards im Jahr 2008 auch für Morgan Tsvangirai eingesetzt, den Oppositionsführer Simbabwes, der gegen den diktatorischen Präsidenten Robert Mugabe antrat.
Vanguard ist auch in Somalia aktiv
Einige Projekte von Trippi und Christopher Harvin aus der Zeit vor der Gründung von Vanguard sind umstritten. Beide arbeiteten 2011 für die Regierung von Bahrain, die zuvor mit Gewalt Proteste niedergeschlagen hatte. Harvin, der auch für Donald Trump Wahlkampfauftritte organisiert und Pressearbeit gemacht hat, ist überzeugt, er habe damit einem wichtigen Verbündeten Amerikas in einer unruhigen Region geholfen. Trippi wollte damals über soziale Medien den Dialog zwischen den Bürgern und der Regierung in Bahrain verbessern, zog sich aber nach einigen Monaten zurück, weil er keine Fortschritte sah. Nach wie vor steht er hinter diesem Versuch, räumt jedoch ein: „Wahrscheinlich war es naiv, anzunehmen, man könne dies in einem solchen Umfeld erreichen.“
Vanguard betont, man wolle nur Kandidaten und Politikern helfen, die sich für Reformen, Demokratie, Transparenz und freie Wahlen einsetzten. Bislang ist die Organisation offiziell erst bei zwei Wahlen aktiv geworden – in Gambia und in Somalia, wo man Fadumo Dayib unterstützte, Somalias erste weibliche Präsidentschaftskandidatin. Sie zog ihre Kandidatur allerdings zurück, weil sie eine Manipulation der Wahl befürchtete.
Die Menschen in Gambia begrüßten weitgehend die Unterstützung von Vanguard, meint Ebrima Sall, Exekutivsekretär des Rats für Entwicklung und Sozialforschung in Afrika (CODESRIA) in Dakar, der selbst aus Gambia stammt. Sie sollte allerdings nicht in den Schatten stellen, was die Einheimischen selbst erreicht haben. „Die Menschen in Gambia sind sehr stolz darauf, dies aus eigener Kraft geschafft zu haben.“ Auch Barrow ist dankbar für die Hilfe. „Gambia hatte die Unterstützung nötig, fünf Jahrzehnte hat es gedauert, bevor so etwas möglich war, zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung“, erklärt er.
Kritiker empfinden es als problematisch, dass sich Gambier bei Amerikanern für ein Wahlergebnis bedanken. Steve McDonald, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wilson Center in Washington, attestiert Vanguard hingegen, „mit offenen Karten“ zu spielen. Durch ihren gemeinnützigen Status sei die Organisation auch teilweise gegen Kritik gefeit, die sich häufig gegen bezahlte Berater richtet. Aber er gibt auch zu bedenken: „Es ist schon eine Gratwanderung.“ Die Verbindung zu einem US-Unternehmen, das einem Kandidaten helfe, lasse sich auch negativ auslegen – ob mit Recht oder nicht.
Smith und seine Kollegen sind sich darüber im Klaren, dass Vanguard Kritiker auf den Plan rufen wird – erst recht, wenn man die Arbeit auf weitere Länder ausdehnt. „Egal was wir tun, Leute, die ein Interesse am Erhalt ihrer Macht haben, werden uns als Neokolonialisten darstellen“, sagt er. „Selbst dann, wenn wir nur unterstützen, was die Menschen dort bereits selbst fordern.“
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
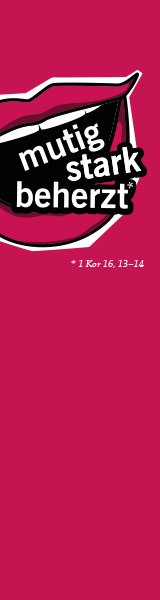
Neuen Kommentar hinzufügen