Wer verantwortlich Entwicklungshilfe leisten will, muss kritisch über sie nachdenken: Mit dieser Forderung rannte Thomas Gebauer von der Frankfurter Hilfsorganisation medico international offene Türen ein. Stabilisiert Entwicklungshilfe manchmal ausbeuterische Verhältnisse?
Ja, sagt Gebauer, besonders seit die Hilfe vom Neoliberalismus der jüngsten Jahrzehnte infiziert sei. So stellten auch Hilfsorganisationen Armut und Not nicht mehr als Frage sozialer Rechte, sondern privater Mildtätigkeit dar. Die Mikrokredit-Branche behandle Arme als Unternehmer, die selbst verantwortlich seien, wenn sie scheitern. Und das Managementdenken aus der Geschäftswelt sei in nichtstaatliche Organisationen (NGOs) eingezogen: Man plane und messe Wirkungen von Projekten, statt sich für soziale Veränderungen einzusetzen, die nie planbar seien und gegen scheinbar übermächtige Gegner erkämpft werden müssten.
Klagen über die Folgen des Neoliberalismus zogen sich durch eine Reihe von Beiträgen der Konferenz, die medico zusammen mit der Heinrich-Böll- und der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem Institut für Sozialforschung der Universität Frankfurt ausgerichtet hatte. Der haitianische Filmemacher Raoul Peck spitzte die Denkfigur zu: Die Hilfe sei in den Kapitalismus integriert und deshalb nicht mehr zu retten. Gebauer will sie dennoch retten, indem er Solidarität mit den Kämpfen um Menschenrechte in den Vordergrund rückt – Hilfe dürfe nie neutral sein. Das fand breiten Anklang.
Ist die Hilfe zu sehr oder zu wenig neutral?
Einige allerdings warnten vor zu schlichten Antworten. Die Alternativen jenseits von Hilfe – nämlich die Menschenrechte sowie die auf gegenseitiger Abhängigkeit beruhende Solidarität – haben laut Axel Honneth vom Institut für Sozialforschung ihre eigenen Tücken: Für die Menschenrechte fehle eine Instanz, sie international durchzusetzen; und bei internationaler Solidarität sei Gegenseitigkeit nur eine Fiktion.
Die humanitäre Hilfe sei anders als Entwicklungshilfe nicht zu sehr, sondern zu wenig neutral und lasse sich zu oft im Krieg benutzen, sagte Cornelia Füllkrug-Weitzel von Brot für die Welt.
Bernd Bornhorst von Misereor räumte ein, dass NGOs lange zu wenig „Sand im Getriebe“ waren, doch das Pendel schwinge jetzt zurück. Die Debatte, ob wir als Teil des Systems überhaupt zu seiner Überwindung beitragen könnten, sei jedoch theoretisch und interessiere die Partner im Süden nicht. Ein Teilnehmer aus der staatlichen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erkannte hinter den Klagen über Entpolitisierung und Neoliberalismus gar die Sehnsucht nach klaren Unterscheidungen zwischen Gut und Böse. Er riet, moralische Dilemmata in der Praxis zu ertragen, statt die Systemfrage zu stellen und sich so in die moralische Komfortzone zurückzuziehen. (bl)
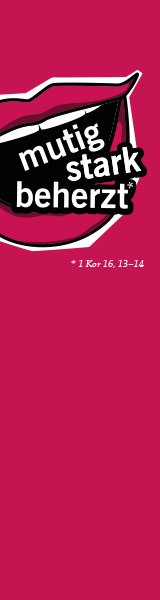
Neuen Kommentar hinzufügen