In der Côte d’Ivoire haben im Oktober und November 2010 endlich die ersten Präsidentschaftswahlen seit 2000 stattgefunden. Sie waren sechs Mal verschoben worden und sollten die akute soziale und politische Krise des Landes beenden. Stattdessen haben sie das Land an den Rand eines neuen Bürgerkrieges geführt.
Autorin
Maja Bovcon
forscht und promoviert an der Universität Oxford über die Politik in der Côte d’Ivoire und die Beziehungen des Landes zu Frankreich.Die tiefere Ursache des Konfliktes ist die kontroverse Frage der Ivoirité, der ivorischen Nationalität. Zu Anfang betraf sie die Bedingung für eine Präsidentschaftskandidatur; so wurde die Kandidatur von Alassane Ouattara bei den Wahlen 1995 und 2000 mit der Begründung verhindert, er sei Ausländer und stamme aus dem Nachbarland Burkina Faso. Schnell jedoch durchdrang das Prinzip der Ivoirité alle Bereiche der ivorischen Gesellschaft: Für den Erwerb der Staatsbürgerschaft und von Landrechten wurden strengere Vorschriften eingeführt, die verlangten, dass der Antragsteller und seine Eltern gebürtige Ivorer sind. Diese neue restriktive Definition von ivorischer Nationalität, formuliert von Intellektuellen aus dem Süden des Landes, hatte vor allem ein Ziel: einen großen Teil der Bevölkerung – hauptsächlich Mitglieder ethnischer Gruppen aus dem Norden – an den Rand zu drängen, indem sie mit Immigranten aus Burkina Faso, Mali und Guinea in einen Topf geworfen wurden.
Die Spannungen, die aus dieser ausgrenzenden und fremdenfeindlichen Politik resultierten, führten im September 2002 zu einem gescheiterten Militärputsch. Daraus entstand ein Bürgerkrieg zwischen der Regierung unter Laurent Gbago mit Sitz im Süden und den Rebellengruppen (den „Neue Kräften“) unter der Führung von Guillaume Soro im Norden. Neutrale Truppen – Franzosen sowie Friedenstruppen der Vereinten Nationen (UN) und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) – errichteten eine Pufferzone zwischen beiden Seiten. Das beendete den Krieg und spaltete die Côte d’Ivoire in einen nördlichen Teil in der Hand der Rebellen und einen von der Regierung kontrollierten südlichen Teil.
Schon mit der Unterzeichnung des Abkommens von Linas-Marcoussis im Januar 2003 einigte man sich auf Bedingungen für die Lösung des Konflikts: weniger restriktive Wählbarkeitskriterien; Aufnahme der Wahlberechtigten ins Wahlregister; Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration der Rebellen und Milizen sowie die Vorbereitung freier und fairer Wahlen. Fast sieben Jahre mussten vergehen und zahlreiche weitere Friedensabkommen unterzeichnet werden, bevor diese wichtigen Punkte des Friedensplans mehr oder weniger erfolgreich umgesetzt waren.
Schließlich begann der Wahlprozess vielversprechend. Alassane Ouattara, der wichtigste Oppositionsführer, durfte seine Kandidatur einreichen. In einem langen und mühsamen Identifizierungs- und Registrierungsverfahren erhielten manche der vorher zu Unrecht ausgeschlossenen Ivorer die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht. Obwohl die endgültige Wählerliste möglicherweise mangelhaft war – sie enthielt mit etwa 5,7 Millionen Wahlberechtigten erheblich weniger als die anfänglich geschätzten 8 Millionen –, verlief die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 31. Oktober 2010 ohne größere Zwischenfälle und mit einer historisch einmaligen Wahlbeteiligung von 85,11 Prozent. Der Amtsinhaber Laurent Gbagbo erreichte 38,3 Prozent der Stimmen und Alassane Ouattara gut 32 Prozent. Henri Konan Bédié, der von 1993 bis 1999 Präsident gewesen war, erhielt gut 25 Prozent. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen hatte, fand am 28. November die Stichwahl zwischen Gbagbo und Ouattara statt.
Die Spannungen wuchsen, als das Gbagbo-Lager die unabhängige Wahlkommission daran hinderte, die vorläufigen Ergebnisse der zweiten Runde vor Ablauf der festgelegten Frist bekanntzugeben. Gemäß der ivorischen Verfassung musste dann das Verfassungsgericht die Wahl für gültig erklären. Paul Yao N’Dre, dessen Präsident und ein enger Verbündeter Gbagbos, wies die verspätete Erklärung der Wahlkommission zurück, Ouattara habe die Wahl mit 54,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Dieses Ergebnis erklärte die internationale Gemeinschaft nahezu einstimmig für glaubwürdig und drängte Gbagbo zum Rücktritt. Doch das Verfassungsgericht annullierte die Stimmen aus sieben umstrittenen Regionen im Norden, der Hochburg Ouatarras, und rief Gbagbo mit 51,45 Prozent der Stimmen zum Gewinner aus. Beide Kandidaten ließen sich als Präsident vereidigen und bildeten eine Regierung.
So hat die lange erwartete Präsidentschaftswahl, die das Land wieder vereinen und die politische Führung legitimieren sollte, die Konflikte nur verschärft. Sie bestätigte lediglich, was schon bekannt war: Die Benutzung der Ivoirité hat das Land entlang ethnisch-regionaler Grenzen gespalten, die keiner der drei Präsidentschaftskandidaten überschreiten kann oder will. Seit der Stichwahl haben Gbagbo-treue Sicherheitskräfte und Milizen Hunderte Menschen getötet oder verwundet und Dutzende in nächtlichen Razzien entführt und in geheime Internierungslager gebracht. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge hatte die Zahl der nach Liberia geflohenen Ivorer im März bereits mehr als 70.000 erreicht, weitere 200.000 waren innerhalb des Landes vertrieben.
Der Bürgerkrieg droht nach den tödlichen Zusammenstößen zwischen beiden Lagern im März erneut aufzuflammen, zumal das Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Kämpfern nicht vollständig umgesetzt worden ist: Laut dem neuesten Fortschrittsbericht der UN vom November 2010 sind von 37.451 Milizsoldaten nur 17.301 entwaffnet und von 32.777 registrierten Rebellen nur 17.601 demobilisiert worden. Die laufende heimliche Bewaffnung beider Lager und die Rekrutierung von – zumeist liberischen – Söldnern für das Gbagbo-Lager sind dabei natürlich gar nicht berücksichtigt.
Die Staatengemeinschaft erwägt gegenwärtig mehrere Möglichkeiten, um einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern. Die ECOWAS hat mehr als einmal gedroht, Laurent Gbagbo mit militärischer Gewalt abzusetzen. Das wäre aber mit zahlreichen Problemen verbunden. Eine Militäroperation könnte erstens Millionen Westafrikaner, die in der Côte d’Ivoire ansässig sind, in Gefahr bringen und die gesamte Region destabilisieren. Gbagbo hat die Mitglieder der ECOWAS bereits öffentlich gewarnt, dass eine Intervention einen Bürgerkrieg und Repressalien gegen große Einwanderergruppen aus den Nachbarländern auslösen könne.
Zudem ist die alarmierende Zahl von Flüchtlingen, die in Scharen die Côte d’Ivoire verlassen, eine schwere Belastung für die ohnehin schwachen und armen Nachbarstaaten, vor allem für Liberia. Zweitens ist fraglich, ob die ECOWAS imstande ist, eine solche Militäroperation ohne Hilfe von außen zu starten. Die in der Côte d’Ivoire stationierten Truppen der ECOWAS waren von Anfang an stark auf logistische und finanzielle Unterstützung der Franzosen und der UN angewiesen. Zudem verfügen die ECOWAS-Länder anscheinend nicht über Spezialeinheiten, die einen „Enthauptungsschlag“ zur Absetzung Gbagbos führen können.
Bisher aber hat keiner der potenziellen Helfer einen entscheidenden Schritt zur Unterstützung der ECOWAS-Mission getan. Frankreich, die frühere Kolonialmacht der Côte d’Ivoire, zögert, eine aktive Rolle zu übernehmen. Einer der Gründe ist sicherlich, dass Paris Gbagbo keine weitere Gelegenheit bieten will, sich dadurch stärkere Unterstützung im Land zu verschaffen, dass er die antikolonialen Gefühle anheizt – eine Taktik, die er bereits erfolgreich angewendet hat. Frankreich scheint entschlossen, den Fehler vom November 2004 zu vermeiden, als eine unvorhergesehene direkte militärische Konfrontation mit dem Gbagbo-Regime zu gewalttätigen antifranzösischen Protesten führte.
Der nigerianische Außenminister hat für eine ECOWAS-Militärintervention ausdrücklich „eindeutige internationale Unterstützung“ durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gefordert. Dieser hat zwar zusätzliche 2000 Blauhelmsoldaten zur Aufstockung des 9800 Mann starken UN-Kontingents beschlossen, aber nicht dessen Mandat ausgeweitet, das zurzeit auf den Schutz von Zivilisten beschränkt ist. Darüber hinaus haben sich die UN, obwohl die Angriffe der Sicherheitskräfte und Milizen Gbagbos auf die UN-Friedenstruppen stark zugenommen haben, nicht mehr getan, als ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Bevor man aber den UN und der Staatengemeinschaft pauschal mangelnde Entschlossenheit vorwirft, muss betont werden, dass die Lage äußerst heikel ist. Fast die Hälfte der Wähler hat für Gbagbo gestimmt, er kontrolliert die staatlichen Sicherheitskräfte, zahlreiche Milizen und die staatlichen Medien. Zudem genießt er die Unterstützung von Jugendgruppen, die als „Junge Patrioten“ bekannt und mehr oder weniger bewaffnet sind. Es ist durchaus möglich, dass selbst eine gelungene „Entführungsoperation“ die Rache dieser Gruppen hervorrufen und Unruhen auslösen würde.
Viele Länder und internationale Organisationen – darunter die USA, die Europäische Union, die UN und die Weltbank – haben gegen das Gbagbo-Regime finanzielle Sanktionen verhängt wie Einfrieren von Geldern und Reisebeschränkungen. Außerdem gehört die Côte d’Ivoire zur Währungsunion von acht westafrikanischen Ländern mit einer gemeinsamen Zentralbank, der Central Bank of West African States. Ouattara hat diese Bank angewiesen, Gbagbo den Zugang zu den Konten des Landes zu sperren, und ein Exportverbot für Kakao angeordnet. Diese Sanktionen trocknen Gbagbos Geldvorräte allmählich aus. Das zeigen seine jüngsten verzweifelten Maßnahmen zur Verstaatlichung des Kakaohandels und ausländischer Handelsbanken.
Man sollte aber die Kosten dieser Sanktionen nicht ignorieren. Ungefähr sechs Millionen Ivorer sind zum Überleben in erster Linie auf die Einnahmen aus dem Kakaohandel angewiesen und daher die Hauptleidtragenden eines Exportverbots für Kakao. Überdies könnte Gbagbos Unvermögen, die Armee zu bezahlen, Soldaten dazu treiben, sich mittels Erpressung von Zivilisten ihren Lohn selbst zu beschaff en. Die ivorische Armee ist in Westafrika berüchtigt als Meister der Erpressung. Schließlich wird, da die Côte d’Ivoire die größte Wirtschaftsmacht in der Währungsunion ist, der wirtschaftliche Niedergang des Landes die Wirtschaft der ganzen Gemeinschaft in Mitleidenschaft ziehen. Ohne Ausgleichsmaßnahmen werden die Finanzsanktionen verheerende Folgen für die nationale und regionale Ökonomie haben.
Gbagbo hat öff entlich erklärt, dass er für einen direkten Dialog mit Ouattara offen sei. Ouattara hat bisher eine Machtteilung mit Gbagbo abgelehnt, jedoch die Möglichkeit ins Auge gefasst, Gbagbos Verbündete in seine Regierung zu holen, solange Gbagbo abtritt und Ouattara als den rechtmäßigen Wahlsieger anerkennt. Die USA, die ECOWAS und die AU lehnen ein Machtteilungsabkommen mit Gbagbo entschieden ab und erklären, dass die Wahlergebnisse eindeutig seien. Dies lässt sich teilweise mit den Erfahrungen in Kenia und Simbabwe erklären. Dort wurden Krisen, die aus der Weigerung des Amtsinhabers zum Rücktritt nach einer Wahlniederlage entstanden waren, mit der Bildung einer vorläufigen Einheitsregierung gelöst. In beiden Fällen hat man damit aber wenig mehr erreicht, als den instabilen Status quo zu verlängern, durch den staatliche Institutionen weiter zersetzt, ihre Rechenschaftspflicht untergraben, die Opposition geschwächt und ein Klima der Straffreiheit und Korruption begünstigt wurden.
Beispiele für schlechte Machtteilungsabkommen bietet auch die Côte d’Ivoire selbst. Das Land hat seit dem ersten Militärputsch im Dezember 1999 etliche mehr oder weniger ineffiziente vorläufige Einheitsregierungen erlebt. Besonders die letzte, ein Ergebnis der Unterzeichnung des Vertrages von Ouagadougou zwischen Gbagbo und Soro 2007, sollte eine Lehre sein, Gbagbos Bereitschaft zur Machtteilung skeptisch zu betrachten. Er ist ein raffinierter Führer und weiß, wie er eine Einheitsregierung nutzen kann, um seine Macht zu stärken und die Opposition kaltzustellen.
Dennoch sollte eine Machtteilung nicht ausgeschlossen werden. Ouattaras Angebot, eine Einheitsregierung mit Mitgliedern aus Gbagbos Kabinett, aber ohne Gbagbo zu bilden, erscheint als wünschenswerte Möglichkeit, einen erneuten Ausbruch des Bürgerkrieges zu vermeiden. Das Problem ist, dass eine Entscheidung Gbagbos für einen „würdigen Abgang“ immer unwahrscheinlicher wird, obwohl die USA und die ECOWAS ihm Amnestie und eine Zuflucht anbieten. Gbagbo zählt bestimmt nicht zu den größten Diktatoren der Welt, er dürfte aber trotzdem den Verlust der Immunität befürchten, die er als Präsident genießt. Denn es ist möglich, dass er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird. Hier gibt es einen Präzedenzfall: Dem früheren liberianischen Präsidenten und Kriegsherrn Charles Taylor bot Nigeria 2003 Asyl an, überlegte es sich dann 2006 aber anders und ließ zu, dass er verhaftet und vor ein internationales Gericht gestellt wurde. Das kann künftig verbrecherische Führer, darunter Gbagbo, veranlassen, solchen Asylangeboten zu misstrauen.
Die Präsidentschaftswahl hat das Land an den Rand des Bürgerkrieges gebracht. Es war naiv von der Staatengemeinschaft, zu erwarten, dass eine Wahl die Wunden heilen und unbeeinträchtigt von der Tatsache bleiben würde, dass die Armee, die Medien und das Verfassungsgericht fest in der Hand des Amtsinhabers sind. Die Krise könnte nun dem Demokratisierungsprozess insgesamt schaden: Dass die Staatengemeinschaft unwillig und/oder unfähig ist, zur Achtung der Wahlergebnisse beizutragen, könnte das Vertrauen der Wähler in den Urnengang schwächen und künftig ihre Wahlbereitschaft verringern. Schlimmer noch: Die Krise nach der Wahl könnte sie davon überzeugen, dass nur die Sprache der Gewalt gehört und verstanden wird.
Aus dem Englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.
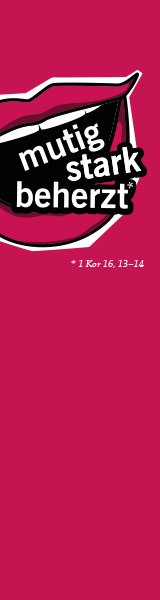
Neuen Kommentar hinzufügen