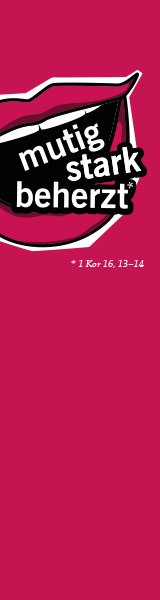Ein Teil der Ernte ist dahin. „Kali Massi“, schwarze Flecken, heißt die Krankheit, die im indischen Bundesstaat Rajasthan den Schlafmohn befallen hat. „Es wurde zu früh und zu schnell zu heiß“, erklärt Chhganlac Jat, der Dorfvorsteher von Nimbahida Goraji Ka. „Deswegen bilden sich die schwarzen Punkte auf der Pflanze.“ Nach dem Ausbleiben des Monsunregens im vergangenen Jahr ist dieses neue Ungemach ein schwerer Schlag für die Opiumbauern. 80 der 500 Familien im Dorf haben eine Lizenz vom indischen Zentralbüro für Betäubungsmittel (Central Bureau for Narcotics, CBN). Damit dürfen sie auf einer Fläche von bis zu einem halben Hektar Schlafmohn anbauen, aus dem Morphium und Codein für die Produktion von Arzneimitteln gewonnen wird. Manche von ihnen verlieren mit der Krankheit der Pflanzen einen großen Teil ihres Jahreseinkommens.
Dabei sollen diese indischen Bauern doch als Vorbild für Afghanistan dienen. So sieht es zumindest die nichtstaatliche Organisation ICOS (International Council on Security and Development), die früher unter dem Namen Senlis Council firmierte. Seit 2005 setzt sie sich unter dem Slogan „Poppy for Medicine“ für den versuchsweisen Anbau von Opium für medizinische Zwecke in Afghanistan ein (siehe welt-sichten 6/2008). Ihr bislang größter Erfolg war ein – allerdings folgenloser Beschluss – des Europaparlaments, ein solches Projekt zu verwirklichen.
Mit seinen Plänen stößt ICOS weiter auf Widerstand. Trotz legalen Anbaus würde der illegale Opiumanbau in Afghanistan weitergehen, wenden Experten ein. Es sei nicht zu verhindern, dass legal angebautes Opium auch auf dem illegalen Markt lande. Dies würde zudem die Korruption fördern. Ferner wird bezweifel, dass es einen Markt für medizinisches Opium aus Afghanistan gibt. Und schließlich habe das Land nicht die Kapazitäten, um eine pharmazeutische Industrie aufzubauen.
Autor
Lorenz Matzat
ist freier Journalist in Berlin.Der frühere Leiter der indischen Drogenbehörde, Romesh Bhattacharji, und ICOS-Mitarbeiter Jorrit E. M. Kamminga halten diese Einwände für nicht überzeugend. Der Erfolg des Projekts sei nur zu testen, indem man es verwirkliche, schreiben sie in einem gemeinsamen Artikel. Zwar würde ein legaler Opiumanbau die illegale Produktion nicht beenden, aber afghanischen Bauern den Ausstieg aus der Drogenökonomie ermöglichen. Derzeit gelangten 100 Prozent der Opiumernte in Afghanistan auf den Schwarzmarkt – ein legaler Anbau würde diesen Anteil senken. Dass weiterhin illegal Opium in Afghanistan angebaut werde, liege vor allem am Heroinkonsum in Europa und in den Ländern der Russischen Föderation. Dieses Problem müsse dort gelöst werden. Die beiden Autoren weisen auch den Einwand zurück, eine Legalisierung des Opiumanbaus enthalte die Gefahr der Korruption: Schließlich sei Korruption bislang auch kein Hinderungsgrund für andere Entwicklungsprojekte in Afghanistan gewesen. Für die Organisation und die Kontrolle des legalen Anbaus solle auf die traditionellen kommunalen Selbstverwaltungsstrukturen zurückgegriffen werden. Dafür könnten auch die Erfahrungen aus Indien genutzt werden.
Tatsächlich kann Indien auf eine lange Tradition des kontrollierten Opiumanbaus zurückblicken. Schon unter den Mogulherrschern vor 500 Jahren wurde der Anbau besteuert; im 18. Jahrhundert begann die Britische Ostindien-Kompanie das Geschäft zu übernehmen. Mitte des 19. Jahrhundert führten die britischen Kolonialherren zwei „Opiumkriege“ in China, um dort die Substanz aus Indien weiter im großen Stil einführen zu können. Schließlich wurde 1950 die Drogenbehörde CBN gegründet. Die indische Regierung unterzeichnete 1961 die erste Drogenkonvention der Vereinten Nationen, die den Anbau von Opium, Koka und Cannabis nur noch für medizinische und wissenschaftliche Zwecke erlaubt. Seitdem werden in Indien Mohnpflanzen ausschließlich in drei aneinandergrenzenden Bundesstaaten angebaut: Rajasthan, Madhya Pradesh sowie Uttar Pradesh.
Ebenfalls zu Beginn der 1960er Jahre hatte die US-amerikanische Drogenbehörde Drug Enforcement Administration (DEA) sich auf eine bis heute gültige „80-zu-20“ Regel festgelegt: Ihren Bedarf an den Rohstoffen für Opiate müssen die Vereinigten Staaten seither zu 80 Prozent aus Indien und der Türkei decken – wohl ein Zugeständnis an diese traditionellen Anbauländer, um sie zum Unterzeichnen der Drogenkonvention zu bewegen. In der Türkei – dem Land mit dem größten legalen Opiumanbau auf 70.000 Hektar Anbaufläche im vergangenen Jahr – wird mittlerweile mit Hilfe von Maschinen geerntet; damit ist Indien das einzige Land der Erde, in dem Opium auf legale Weise traditionell per Hand gewonnen wird.
Die Behörden der Anbauländer melden die Größe der Anbauflächen und die Erträge jährlich dem internationalen Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen in Wien (International Narcotics Control Board, INCB). Er regelt den Vertrieb organischer und chemischer Substanzen, die den UN-Drogenkonventionen unterliegen. Der Rat vergibt die Lizenzen und gibt Anbaumengen vor. Regierungen müssen ihm den jährlichen Bedarf ihrer medizinischen Einrichtungen und Pharmaunternehmen melden. Deutschland beispielsweise hat für 2010 einen Bedarf an knapp zwei Tonnen Morphium und 46 Tonnen Codein angemeldet.
So gelten auch für den Opiumanbau in Indien strenge Vorgaben. Die Felder werden von der Drogenbehörde CBN regelmäßig vermessen. Während der Ernte führt ein Ombudsmann im Dorf für jeden Bauern ein Buch, in das jedes geerntete Gramm Rohopium eingetragen werden muss. Mehrmals in der Woche kommen Mitarbeiter des CBN zur Kontrolle.
Ob die Kontrolle funktioniert, ist aber umstritten. Dutzende, wenn nicht hunderte Tonnen aus der legalen Ernte landeten trotzdem auf dem Schwarzmarkt, heißt es in einer Studie belgischer Wissenschaftler aus dem vergangenen Jahr. Indien sei nach Afghanistan und Burma sogar der drittgrößte Produzent illegalen Opiums. Genaue Informationen gibt es allerdings nicht – die Ergebnisse von Satellitenauswertungen über Anbauflächen etwa werden von der indischen Regierung nicht veröffentlicht. Aber es ist bekannt, dass in den Bergen im Norden Indiens, an der Grenze zu Kaschmir und Pakistan, ebenfalls illegale Mohnfelder blühen. Das gilt auch für den Nordosten, eine Region mit einer Vielzahl lokaler Aufstandsbewegungen.
Die Behörden versuchen das Abzweigen von legalem Opium für den Schwarzmarkt mit einer Reihe von Maßnahmen zu verhindern. Die Anbaulizenz für das jeweils kommende Jahr wird von einem Mindestertrag abhängig gemacht, der sich jedes Jahr erhöht: Dieses Jahr mussten pro Hektar mindestens 58 Kilogramm Rohopium mit einem bestimmten Reinheitsgrad abgeliefert werden, 1995 lag die Vorgabe erst bei 43 Kilo. So soll auch erreicht werden, dass die Bauern ihre Anbaumethoden und ihr Saatgut verfeinern. Als Anreiz erhalten die Bauern bei einem höheren Ertrag als im Vorjahr mehr Geld pro Kilo. Erkrankt ein Teil der Pflanzen wie in diesem Jahr, kann der Bauer das Feld unter Aufsicht der Behörde ungeerntet umpflügen und die Fläche aus der Rechnung herausnehmen, um den Mindestertrag pro Hektar zu erbringen.
Die Aussaat und die Bewässerung der heranwachsenden Pflanzen erledigen die indischen Bauernfamilien selbst. Doch für die etwa zwanzig Tage der Ernte zwischen Ende Februar und Mitte März heuern sie zusätzlich erfahrene Arbeitskräfte an. Sie arbeiten sich in meist glühender Hitze Schritt für Schritt, Kapsel für Kapsel durch das Feld. Das Ritzen der Mohnkapseln erfordert Fingerspitzengefühl: Geht der Schnitt des Messers mit den vier feinen Klingen zu tief, tritt zu viel weißlicher Opiumsaft hervor und tropft zu Boden. Ist der Schnitt zu flach, wird der Gehalt der Kapsel nicht optimal ausgebeutet. Über Nacht gerinnt der Saft zu einer bräunlichen Substanz, dem Rohopium, das mit einem sichelförmigen Eisen abgestreift wird. Dreimal wird dieser Vorgang pro Kapsel wiederholt. Ein arbeitsintensiver Vorgang, denn auf einem halben Hektar wachsen ungefähr 50.000 Pflanzen.
Je nach Anbaufläche verdienen die indischen Opiumbauern zwischen 500 und 1000 Euro an ihrer Ernte – das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen in Indien liegt bei etwa 700 Euro. Neben dem Rohopium verkaufen sie Mohnsamen, die beispielsweise geröstet auf Mohnbrötchen landen. Die indische Regierung selbst hat mit dem Verkauf von Opium von den landesweit 45.000 lizenzierten Mohnbauern an US-Pharmafirmen im vergangenen Jahrzehnt jährlich circa zehn Millionen Euro Gewinn gemacht.
An Afghanistan als Konkurrenten auf diesem Markt dürfte Indien deshalb kaum Interesse haben – ebenso wenig die anderen großen Anbauländer Tschechische Republik, Türkei, Australien und Frankreich. Denn der Bedarf an medizinischen Opiaten ist laut Suchtstoffkontrollrat INCB gedeckt; er entspricht in etwa einer Menge von Alkaloiden, die aus 5500 Tonnen Rohopium gewonnen werden könnte. Zum Vergleich: Laut UN wurden 2009 in Afghanistan fast 7000 Tonnen Opium geerntet. Doch die Befürworter eines legalisierten Anbaus in Afghanistan von der Organisation ICOS halten die Angaben des INCB für falsch. Der gebe selbst zu, dass 80 Prozent der legalen Opiate von nur acht Industrieländern verbraucht werde. Vier Fünftel der Weltbevölkerung dagegen hätten keinen Zugang zu den Schmerzmitteln, die vor allem bei Krebserkrankungen, aber auch in der Palliativmedizin benötigt würden.
Das bemängelt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht sogar von einer Menschenrechtsverletzung. Laut ihrem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht über Indien mit dem Titel „Unerträgliche Schmerzen“ erhalten 70 Prozent der indischen Krebspatienten kein Morphium – zum einen weil es in den Krankenhäusern schlicht nicht verfügbar sei, zum anderen weil beim medizinischen Personal eine überzogene Angst vor seinem Suchtpotential herrsche.
Die Frage, ob der legale Opiumanbau in Indien ein Modell für Afghanistan sein kann, lässt sich wohl nur mit Hilfe des von ICOS geforderten Pilotprojektes klären. Im Grunde bringt der Schlafmohn nur ein Agrarprodukt hervor: Rohopium. Zum Politikum wird die Substanz durch einen Federstrich im Gesetzestext: gute Arznei oder böse Droge. In den afghanischen Provinzen Helmand und Kandahar wurde in diesem Frühjahr Krieg gegen eine Pflanze geführt. Zur selben Zeit tranken 1200 Kilometer östlich in Rajasthan Mitarbeiter der indischen Drogenbehörde mit Opiumlandwirten Tee. Gemeinsam beugte man sich über die Erntebücher und begutachtete die Felder. Und ein Beamter stellte leicht amüsiert fest: „Die Bauern kümmern sich um die Mohnpflanzen wie um ihre Kinder.“
Die Reise in das indische Opiumanbaugebiet hat der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) mit einem Recherchestipendium unterstützt.